
Wenn man am Ende immer schlauer ist, dann weiß ich am Ende eines ganz gewiss: Ich habe den Mund etwas zu voll genommen. In dem Moment, in dem ich die Brille vom Kopf reiße, diese hautenge und alles gelb-machende Taucherbrille, die mir, wie lange? Vier Stunden? Acht Stunden? das Sichtfeld, meinen wichtigsten Sinn verwehrt hat, blicke ich wie ein gehetztes Tier in das Gesicht eines freundlich und mitfühlend aussehenden jungen Mannes, der keine zwanzig Zentimeter vor mir hockt, danach in die groß bebrillten Augen einer blonden Soldatin mir rotem Kreuz am Arm. Erster Impuls: Okay, die waren auch eben da, die kümmern sich um mich. Aber: Wer seid ihr? Wo ist ein vertrauter Fixpunkt? Ich stehe auf, mechanisch, wie von selbst, der Körper will jetzt, er muss: Flüchten. Raus hier. Wo genau ich bin kommt erst einige Sekunden später bei mir an. Da habe ich Hauptmann B. bereits erkannt. Der Gedanke, der mir jetzt, zusammen mit den Tränen vor die Stirn, vor die Augen springt, ist: „Papa!“ Natürlich ist das Quatsch und dazu noch unkontrolliert und zutiefst unterbewusst. Aber ich habe es gedacht – ich war dankbar in die Augen dieses, mir nach dieser intensiven Woche ans Herz gewachsenen Soldaten zu sehen. Er erwiderte den Blick auf seine Art: Mitfühlend, empathisch, leise. Er geleitet mich aus dieser Hölle eines Raumes heraus, spricht einige wenige, sehr beruhigende Worte und sorgt mit diesen und seiner Nähe dafür, dass ich mich innerhalb einiger Minuten wieder soweit sammeln kann, dass ich zumindest einige, vielleicht schon reflektierende Gedanken fassen kann. Der einschneidendste und erschlagendste ist noch heute präsent: Schneider, willst Du diesen Scheiß wirklich? Was ist passiert in den letzten fünf Tagen?
Seit fast vier Jahren spinne ich an dem vagen Vorhaben herum, einen Dokumentarfilm über Deutsche meiner Generation zu drehen, die freiwillig und in verschiedenen Berufen in Kriegs- und Krisengebieten arbeiten. Über Recherche, Lektüre und Protagonistensuche bin ich bisher nicht hinaus gekommen, oft lenkt einen das Leben von den Plänen ab. Mit der Anmeldung zu einem fünftägigen Lehrgang zum “Schutz und Verhalten in Krisenregionen” wird das Projekt allerdings konkreter: Der Kurs kostet Geld, Zeit und, wie sich später herausstellen soll, mehr Nerven als zunächst gedacht. Man fährt also aus Berlin heraus gen Franken, steigt mehrfach um, schaut sich die anderen Zuggäste etwas genauer an als sonst: Könnte der da ein Journalist sein? Ist sie da hinten nicht ähnlich bepackt wie ich? In Hammelburg am Bahnhof rottet sich schnell ein kleines Grüppchen zusammen, wobei sich herausstellt: Mit einigen Vermutungen lag ich richtig. Wir werden von unserem Fahrer, mit dem man während der nächsten Tage sehr gut schäkern kann, z.B. über seine Vorliebe für den FCBayern, ob Lewandowski wirklich fünf Tore geschossen hat usw. abgeholt und zur Kaserne gebracht. Dort bekommen wir Schlüssel für die Stuben, Pläne, Anweisungen für das Kennenlerntreffen im Offizierskasino. Er bringt uns zu den Stuben und zum ersten mal weiß ich nicht ob ich erleichtert oder enttäuscht sein soll: Wir haben Einzelzimmer. Damit habe ich nicht gerechnet. So viel Komfort?

Mein Ansatz als Dokumentarfilmer ist es, mich auf die Augenhöhe des porträtierten Laien einzulassen, das heißt: Ich versuche eine Reise gemeinsam mit meinen Protagonisten zu gehen, nicht als Experte oder neunmalkluger Profi, sondern offen für Überraschungen – Film ist immer auch Improvisation. Er gleicht darin von Clausewitz’ Aussage, dass kein Kriegsplan den ersten Zusammenstoß mit dem Feind überlebt. Deshalb habe ich bewusst keine Erfahrungsberichte wie diesen hier gelesen. Ich habe das verschwörerische Lächeln derjenigen, die ich zuvor getroffen und die an diesem Kurs teilgenommen haben ohne Hinterfragen hingenommen. Ich war offen – und naiv. Ich wusste, dass man entführt werden könnte, als Simulation versteht sich. Ich konnte mir denken, dass es nicht schaden konnte, körperlich fit zu sein. Also habe ich etwas trainiert, Ausdauer, viel wandern, einige Liegestützen. Einige Tage vor dem Aufbruch habe ich dann gepackt und kam natürlich nicht umher, das Schreiben mit den empfohlenen Mitbringseln zu lesen. Hier war nun die Rede von „Schäden, für die ich niemanden haftbar machen würde“ und von „Notrationen“, um die man sich kümmern sollte. Ich versuchte, die Ruhe und Vorfreude zu behalten. Die Woche vor dem Lehrgang war ich auf Kreta, sieben Tage Urlaub mit Freunden, ich war erholt und gestärkt und freute mich wirklich auf diese Erfahrung. Dennoch schlich sich nun,beim Packen ein leicht beängstigender Gedanke ein: Was, wenn wir direkt bei unserer Ankunft entführt werden? Wäre das nicht die realistischste Herangehensweise – den Journalisten und Medienschaffenden klar zu verdeutlichen, dass sich eben nicht alle Variablen planen lassen? Von Clausewitz in voller Praxis sozusagen. Als ich in Hammelburg den Bahnsteig betreten habe, war ich so paranoid von diesem Gedanken, über sechs Stunden Zugfahrt hat er sich in mir ausgebreitet und ausgetobt, ich war mir zu einhundert Prozent sicher, dass wir direkt von sturmmaskierten Kalashnikovträgern in ein feuchtes Verlies geworfen werden würden. Stattdessen: Einzelzimmer. Kennernlerntreffen im Offizierskasino mit Griechischem Salat, Calamares und Bier. Sehr nette und vor allem interessante und interessierte Menschen. War ich noch immer auf Kreta? Ich konnte es nicht fassen und war eher enttäuscht als erleichtert. Heute weiß ich: Das war der Moment des zu vollen Mundwerks.
Ich hielt mich dennoch an meine Routine, absolvierte meine Fitnessübungen auf dem Zimmer, ging früh schlafen. Am nächsten Morgen begann der theoretische Unterricht. Nach dem Mittagessen fuhren wir nach Bonnland, diesem fiktiven und entsiedelten Ort, in dem die Bundeswehr ihre Infanterie in Feldwebelprüfungen schickt oder Journalisten wie uns sowie Diplomaten und andere Berufsgruppen, die gerne mal ihr Leben riskieren, seit 2002 versucht auf die zu erwartenden Gefahren vorzubereiten. So verliefen die ersten drei Tage wie ein sehr lehrreicher Abenteuerurlaub mit großem Lerneffekt, vielen „Ahas!“ und „Ohos!“, unzähligen wirklich unterhaltsamen (um nicht zu sagen: verdammt lustigen) Momenten und süßem Adrenalin. In der Theorie lernt man Vormittags, welche Arten von Minen und Sprengfallen es gibt, Nachmittags versucht man sie dann im Felde zu finden. Erkenntnisgewinn am Abend in einer SMS an eine Freundin: „Heute bin ich nur dreimal gestorben. Wir sind viel am Lachen.“ In einem liebevoll sadistisch präparierten Haus ist alles, wirklich alles, eine lebensgefährliche Tricksprengfalle. Vor dem Haus stehen Holzbündel oder Mauern aus Ziegelsteinen, die Schutz simulieren sollen und doch keinen oder bloß geringfügigen abgeben würden. „Die Kugeln gehen eigentlich überall hindurch. Variablen sind die Qualität des Schützen und Zeit. Ausnahme ist zum Beispiel eine Eiche mit Stammdurchmesser ab 80cm.“ Phantastisch. Ob ich so eine Eiche gerade zur Hand habe, wenn, sagen wir mal in Libyen, gerade auf mich geschossen wird, steht auf einem anderen Blatt. Schnell den schwarzen Gedanken verdrängen, wir dürfen jetzt mal die Haptik der Waffen testen. Außer Wasserpistolen und Zündplättchenrevolvern habe ich so etwas noch nie in der Hand gehalten. Geschweige denn diese Kaliber: Scharfschützengewehre, durch dessen Zielfernrohr ich die Augenfarbe einzelner Kursteilnehmer hundert Meter entfernt erkennen kann. Sturmgewehre, mit denen man sich irgendwie Bruce-Willis-mäßig fühlt, inklusive diesem grenzdebilen Grinsen, dass sich augenblicklich automatisiert. Panzerfäuste. Schwere Maschinengewehre. Ich schaue um mich und sehe in einen Spiegel: Journalisten und Reporter, die meisten aufgeklärte, wirklich blitzgescheite Menschen, auf einmal alle mit diesem Blick in den Augen wie kleine Kinder beim Cowboy und Indianer spielen. An einem anderen Nachmittag sind wir auf dem Schießstand und lassen einige Salven über und neben uns feuern. Man hat uns auf alles vorbereitet, wir sind behütet und werden extrem gut betreut, das kann und muss man wirklich sagen. Dennoch ist die Ohrfeige, die man von der eineinhalb Meter neben einem abgefeuerten Panzerfaust bekommt mehr als imposant. Der Scharfschütze trifft auf mehrere hundert Meter Entfernung jeden Schuss ins Ziel. Die Zielscheibe ist immer zerstört bevor man den Schuss überhaupt hört. Sudden Death. Granatwerfer lassen wenig von den Zielscheiben auf der über ein Kilometer entfernten Lichtung übrig. Die Nachfolger des MG 42 zermürben mit ihrem Rasseln, ihrer Geschwindigkeit und Wucht den letzten hoffenden Gedanken, aus so einem Feuersturm unversehrt heraus zu kommen. Ich glaube generell nicht an Glück, in solchen Momenten – wenn diese Simulation einmal ernst werden sollte – sollte man sich daran klammern. Letzte Lektion: Gezündete Sprengladungen. Wir steigern uns bis auf 3KG. Erkenntnis hiernach: Wie es Überlebende im näheren Umkreis einer 100KG Sprengladung geben kann ist absolut unvorstellbar. Auf dem Weg nach oben wird nochmal ohne Vorwarnung auf uns gefeuert. Niemand schmeißt sich auf den Boden, aber verunsicherte Blicke sind auf allen Seiten zu sehen. Die anwesenden Soldaten können sich ein Grinsen nicht verkneifen. An diesem Abend bestellt man im Kasino auch mal ein zweites Bier.

Die Soldaten, die uns diese Dinge beibringen und zeigen, korrigieren nachhaltig mein bis hierhin reichlich nebulöses Bild der Armee. Gewiss: Man hat sich hier mit der Auswahl Mühe gegeben. Unser Hauptmann, die beiden Feldwebel, die Majorin, die uns die Woche über begleiten und ihr Wissen weitergeben sind nicht nur charmant und locker, sie können pointiert reden ohne sich dabei merklich zu verstellen, finden oft markige und ehrliche Worte, verlieren dabei aber nicht ihre Ausstrahlung. Man fühlt sich meistens sehr wohl bei ihnen und spürt nicht, dass dies für sie eine sich wöchentlich wiederholende Routine ist. Der Oberst mag für manche am Tisch streitbar sein, redet von Anfang bis Ende jedoch erfrischend druckreif, ist um keinen Scherz und vor allem keine selbstironische Bemerkung verlegen. Was davon Professionalität, was Schauspiel und was Ehrlichkeit ist – das wird man nicht immer sicher sagen können. Aber was im Kasino ausgesprochen wird, so sagt es das ungeschriebene Gesetz, wird nicht zitiert. Und, auch wenn es für viele nicht die Wahrheit sein mag – es ist zumindest wahrhaftig, denn hier ist niemand darum verlegen, mit seinen Worten nicht auch etwas Angriffsfläche zu bieten. Das ist mein persönlicher Eindruck, es war auch in manchen Situationen spürbar, dass es nicht allen in der Gruppe so erging, anders herum betrachtet war ja auch nicht jeder in der Gruppe untereinander spontan Best Friend Forever. Mir kam es jedoch durchgängig so vor, als täte sich die Bundeswehr mit diesen Soldaten selbst einen großen Gefallen, auch in der Außenwahrnehmung. Im Allgemeinen: Sieht man den Kurs so, dass sich zwanzig zerstreute Medienfuzzis in einer Kaserne mit mehreren Tausend Infanteristen einnisten, um mal am Abenteuer Krieg mit doppeltem Boden zu schnüffeln, was in manchen Lagen eine durchaus legitime Interpretation der Situation darstellt, könnte man davon ausgehen, dass es mitunter spottende Blicke, gehässige Gesten, blöde Sprüche gegeben hätte. Das Gegenteil war, zumindest in meiner Wahrnehmung der Fall. Hilfsbereit. Aufgeschlossen. Freundlich. So würde ich die Kontakte zu den Soldaten beschreiben, die wir mal wieder, vollkommen verirrt auf immergleichen Korridoren nach dem Weg fragen mussten, oder die uns, wie wir uns in der Mittagssonne räkelnd, kreuzten. Ja, ich hatte durchgängig den Eindruck, man würde uns, Fremdkörper der wir waren hin, kritische Grundhaltung die wir hatten her, respektieren.

Am dritten Tag begannen die Rollenspiele. Eine Gruppe spielt, eine beobachtet, immer im Wechsel. Konzentriert wird sich hier auf zwei Akte: In einem sind die Feinde nicht sichtbar und finden Ausdruck in Heckenschützen, Sprengstoffanschlägen, Granatwürfen aus totem Winkel, in dem anderen treten die Gefahren in Form von aggressiven Zivilisten auf, Hinterhalte, ein wütender Mob. Man muss hier anerkennend den Hut ziehen vor der Realität, die hier anhand von Statisten und Requisite erzeugt wird. Natürlich wissen wir: Diesen Ort gibt es nicht wirklich und verletzen können wir uns auch nur, wenn wir uns zu stürmisch auf den Asphalt schmeißen. Dennoch rast das Herz, man brüllt Ansagen, statt sie in normaler Stimmlage zu formulieren. In einer Situation sehe ich mich instinktiv flüchten, ich lasse meine beiden weiblichen Teammitglieder Hals über Kopf in einem Raum zurück, der vor meinem inneren Auge in den nächsten Sekunden in die Luft gesprengt wird. Im Nachhinein schockiert mich dies, obwohl ich die Macht der Intuition, eines Impulses kenne und respektiere – ich schäme mich dennoch für dieses Verhalten. In einer anderen Situation – wir kauern Schutz suchend in einem Graben und müssen dringend in bessere Schutzstellungen flüchten – packe ich vollkommen automatisch an den Arm der Teammitglieder und helfe ihnen auf die Füße: Die schusssicheren Westen wiegen schwer und verlagern den Körperschwerpunkt, mein Training zahlt sich also doch noch aus. Wir können fliehen ohne von Platzpatronen getroffen zu werden. Paranoia breitet sich aus, hinter jeder Ecke kann eine Gefahr lauern. Der Paketbotendarsteller einer NGO wird harsch von mir angebrüllt, er sieht pakistanisch aus, in meinem jetzigen Wertekalender also „gefährlich“ und er stellt ein großes Paket mitten auf einem belebten Dorfplatz ab, bevor er ohne große Geste verschwindet. Kurz darauf explodiert der Platz und ich bin mir sicher, den Täter beobachtet zu haben. Allerdings war die Bombe an anderer Stelle versteckt, lange bevor ein pakistanischer, dänischer oder australischer Postbote irgendetwas abgestellt haben konnte. Man lernt nie aus. Kurz danach lerne ich noch, wie ich mich verhalte, wenn man in der kleinen Gruppe von einem großen Mob attackiert wird und kein Wort versteht: Man wird sehr klein und demütig. Dieser riesige Mensch, der sein Essen in einem Wutanfall spuckend über uns verteilt, während wir muxmäuschenstill und mit geneigtem Blick auf Hilfe hoffen, ist Angst einflößend, brachial, von monumentaler Statur und rasend vor Wut. Wer jetzt den Mund öffnet, gar frech wird, kommt hier nicht mehr raus – das ist jedem klar. Deshalb lassen wir alles mit uns machen, die Westen und die Rucksäcke abnehmen, wir bieten Geld an, nichts hilft. Ein weibliches Teammitglied wird fortgebracht, plötzlich kommt die Polizei und legt uns durch Handzeichen nahe, zu verschwinden. Diesem Rat folgen wir – und lassen unser Teammitglied zurück. Hals über Kopf handelt der Mensch sehr egoistisch, das war mir vor diesem Tag noch nicht wirklich klar.
Doch die wirkliche Grenzerfahrung beginnt erst am nächsten Tag…
SPOILER ALARM – wer mehr wissen mag kontaktiert mich bitte per eMail oder spricht mich darauf an. Es handelt sich hierbei nicht um Zensur, lediglich um die Bitte, den brisanten Teil auszusparen, damit sich etwaiger Kursteilnehmer noch auf die simulierte Situation einlassen können.

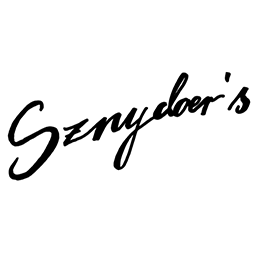

Leave a Reply