MIROW – RHEINSBERG – NEURUPPIN
–
 Keine nennenswerten Schmerzen sind zu spüren am nächsten Morgen, also marschiere ich mit nur einem Liter Wasser und zwei Bananen aus Mirow fort in Richtung Rheinsberg. Irgendwo unterwegs wird sich schon noch Proviant auftreiben lassen. Schließlich ist dies Mecklenburg-Vorpommern und nicht der Kongo, denke ich. Ich laufe durch Dörfer, in denen große Teile der Hausdächer nicht mehr existent sind, tragende Balken liegen frei und werden nicht mehr lange tragen. Natürlich finde ich keine Gelegenheit zum Einkauf, kein Supermarkt, kein Hofverkauf, keine Bäckerei.
Keine nennenswerten Schmerzen sind zu spüren am nächsten Morgen, also marschiere ich mit nur einem Liter Wasser und zwei Bananen aus Mirow fort in Richtung Rheinsberg. Irgendwo unterwegs wird sich schon noch Proviant auftreiben lassen. Schließlich ist dies Mecklenburg-Vorpommern und nicht der Kongo, denke ich. Ich laufe durch Dörfer, in denen große Teile der Hausdächer nicht mehr existent sind, tragende Balken liegen frei und werden nicht mehr lange tragen. Natürlich finde ich keine Gelegenheit zum Einkauf, kein Supermarkt, kein Hofverkauf, keine Bäckerei.
Nach einigen Kilometern beginnt mein Knie wieder zu schmerzen und ich bekomme schlechte Laune. Ich laufe auf einen kleinen Campingplatz zu, vorne auf der Wiese stehen zwei Männer, die mich aus zweihundert Metern Entfernung bereits anstarren, ein Hund kläfft tobend als er mich hört. Als ich auf der Höhe der Männer bin und sie grüße, hat sich einer der beiden bereits abgewendet, der zweite reagiert nicht auf meinen Gruß. Ich bin jetzt nicht mehr schlecht gelaunt, ich bin stocksauer. Der Hund kläfft ohne Unterlass. Ich schaue ihn böse an, als ob das etwas bringen würde und er rennt weiter auf und ab, bis er den Ausgang des Zauns findet und nun auf meiner Seite der Straße auf mich zu rennt. Er ist zwei Meter vor mir und kläfft wie es nur diese kleinen, größenwahnsinnigen Schoßhündchen tun können. Ich trete fest auf den Boden, schreie „Verpiss’ Dich!“ und spucke ihm hinterher. Das bin natürlich nicht ich, das ist die Frustration über die Schmerzen die da aus mir spricht, die desillusionierende Wirkung Mirows und der umgebenden Landschaft, der aufziehende Hunger und die spontane Wut über die beiden wortlosen Gaffer – die Kraftausdrücke sollen sie bitte deutlich hören und mit dem Spucken untermauert meine Körpersprache auf ihrer Augenhöhe, dass es mir ernst ist mit meinem Protest, gegen ihr Verhalten, gegen ihren Hund, gegen diesen deprimierenden Landstrich aus pommerschen Trümmern. Natürlich ist dies zutiefst unsympathisch, natürlich macht es so eine Reaktion nicht besser und ich bin hier ganz klar: Ein Arschloch. Aber ich denke mir, dass wenn ich nett zu den Menschen bin, und sie nicht freundlich reagieren, dann können sie mir auch mal an die blasierten Füße fassen. Und ob sie dann, nachdem das Kind der Zwischenmenschlichkeit und des Zaungesprächs bereits in den Brunnen gefallen ist, denken dass ich frech, ungezogen, und somit ein Drecksack bin, dann ist mir dies herzlich egal. Und mit dieser Wut stakse ich weiter und wünsche dem Campingplatz und seinen Besitzern keinerlei Erfolg in einer miesen und verregneten Saison.
Das wütende Marschieren wird umgehend bestraft: Nach siebzehn Kilometern geht nichts mehr, vor allem nicht: Ich. Eine halbe Stunde warte ich auf einen Bus, der mich die letzte Etappe von Zechlinerhütte bis nach Rheinsberg mitnehmen soll. Als ich dort sitze und meine armen Beine betrachte, hält ein Bus und bringt Flüchtlingskinder von der Schule nach Hause. „Nach Hause“ ist natürlich nicht richtig, er bringt sie in ihre Unterkunft. Zwei Nachbarn, die in ihren Gärten werkeln und sich vorher durch die Hecke über den anstehenden Frühjahrsputz unterhalten haben, sprechen die Kinder an: „Hallo! War Schule gut? Wie viel deutsch?“ Die Kinder sagen Hallo und dass sie seit einem Monat hier sind und dabei lachen sie wirklich bezaubernd. „Jo, die haben immer gute Laune.“ sagt der eine Nachbar zum anderen und ich denke daran, dass mir in der letzten Woche kein Mensch mit einer so dermaßen lebensbejahenden Ausstrahlung über den Weg gelaufen ist wie diese Kinder, die sich hier über Sprache, Essen, Wetter, Mentalität, Willkommenskultur, Fremdenfeindlichkeit, ja, über alles wundern müssen was man sich so vorstellen und nicht vorstellen kann. Sie grüßen auch mich überschwänglich, mich Haufen Elend mit verzogenem Gesicht am Straßenrand und zaubern mir ein grenzdebiles Grinsen in mein müdes und verschwitztes Gesicht, was mich mit der heutigen Wegerfahrung der tiefen Ödnis versöhnt und zuversichtlich Richtung Rheinsberg blicken lässt.
–
Einen Funken dieses Flüchtlingskinderoptimismus und einige ihrer unbesorgten 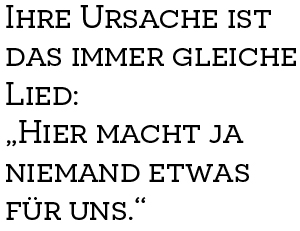 Lachgrübchen wünsche ich dann den Rheinsbergern selbst. In einer Bäckerei werde ich Zeuge eines kläglichen Gesprächs in mehreren Akten. Ein Gast betritt das Geschäft und bestellt, Schrippen, Kuchen, einen Kaffee. Er und die Verkäuferin kommen in ein Gespräch und verfallen umgehend in ein gemeinsames Lamento. Das Bildungssystem sei kaputt, „vor die Hunde gegangen“, man lässt bereits die Alkoholiker auf die Kinder los („ja, der Name fängt mit ‘A’ an, richtig?“), und mittlerweile erklären sogar schon Harzt IV-ler den Schülern das Leben, „also, nicht dass ich Ihnen da jetzt zu nahe… sie wissen was ich meine…“ Denn man weiß ja nie, mit wem man sich dort austauscht. Ihre Ursache ist das immer gleiche Lied: „Hier macht ja niemand etwas für uns.“ Jaja, genau, er nickt, ist ganz mit ihr, nichts wird hier gemacht für einen, für die Kinder schon mal gar nicht. Danke, danke auch, und tschüssi, freundlich lächeln zum Abschied, dann ziehen sich die Mundwinkel wieder nach unten. Die deutsche Idylle rennt in ihrem Eigenverständnis dem Abgrund entgegen, mit Puddingtörtchen und Hefestückchen im Gepäck.
Lachgrübchen wünsche ich dann den Rheinsbergern selbst. In einer Bäckerei werde ich Zeuge eines kläglichen Gesprächs in mehreren Akten. Ein Gast betritt das Geschäft und bestellt, Schrippen, Kuchen, einen Kaffee. Er und die Verkäuferin kommen in ein Gespräch und verfallen umgehend in ein gemeinsames Lamento. Das Bildungssystem sei kaputt, „vor die Hunde gegangen“, man lässt bereits die Alkoholiker auf die Kinder los („ja, der Name fängt mit ‘A’ an, richtig?“), und mittlerweile erklären sogar schon Harzt IV-ler den Schülern das Leben, „also, nicht dass ich Ihnen da jetzt zu nahe… sie wissen was ich meine…“ Denn man weiß ja nie, mit wem man sich dort austauscht. Ihre Ursache ist das immer gleiche Lied: „Hier macht ja niemand etwas für uns.“ Jaja, genau, er nickt, ist ganz mit ihr, nichts wird hier gemacht für einen, für die Kinder schon mal gar nicht. Danke, danke auch, und tschüssi, freundlich lächeln zum Abschied, dann ziehen sich die Mundwinkel wieder nach unten. Die deutsche Idylle rennt in ihrem Eigenverständnis dem Abgrund entgegen, mit Puddingtörtchen und Hefestückchen im Gepäck.
Man kann in Rheinsberg angeln, jagen, wandern, mit dem Boot anlegen, abwechslungsreich speisen, Bücher und vieles mehr in einer schnuckeligen Fußgängerzone weitgehend ohne Franchisegeschäfte einkaufen. Es gibt eine Skateboardanlage und diverse Vereine in Sport und Kultur. Und natürlich gibt es Internet und Bibliotheksausweise und damit den potentiellen Zugang zu unbegrenztem Wissen. Eine ganze kleine Welt voller Möglichkeiten liegt vor den Rheinsbergern, doch darüber lässt es sich so schwierig monieren. Ich möchte gerne wissen was sie erwarten, von einer Achttausendseelengemeinde und vom Staat, von der Gesellschaft, den Kommunen, Ländern, Bund, Volksvertretern, Staatsoberhaupt. Wer macht etwas für mich, in Berlin, Hamburg, Kassel? Liegt es nicht auch an mir selbst, aktiv zu werden und mein Schicksal sowie meine Zeit- und Raumgestaltung soweit wie möglich in die eigenen Hände zu nehmen? Wem gebe ich die Schuld daran, dass ich keine Zuversicht in bessere Zeiten habe und wie sollen diese bitteschön aussehen in einer vollkommen zurechtrestaurierten und sanierten Kleinstadt? Wen kann ich dafür abstrafen, selbst keinerlei Aktionismus zu besitzen? Wenn ich nicht erkenne, dass ich zumindest in der Lage bin mitzugestalten, dann ergebe ich mich der Lethargie. Und Rheinsberg hält alle seine Hände vor dieser Lethargie entwaffnet in die Höhe gestreckt. In den Gesichtern und Dialogen sehe ich dann die Opferrollen, die in der Folge dafür sorgen, dass jeglicher Entscheidungsträger in die Gruppe „die da oben“ eingeordnet wird. Was ist los mit der Anpacker- und Machermentalität der Deutschen?
Ich denke an die Zeit und das System vor der Wende. Es ist eine Epoche, mit der ich nicht in Berührung kam, nicht gespürt habe, wie ein Staat mein, dein, unser Leben versucht zu lenken, korrigiert, plant, schikaniert, feinjustiert und eine Denke in schwarz und weiß, richtig und falsch einzuteilen versucht – und schlussendlich wahrscheinlich vor allem daran zugrunde geht. Vollversorgung, komplette Kümmerung, alle auf einer Augenhöhe – vielleicht war es so. Aber war es dann nicht auch: Sehr unfrei? Eng? Langweilig?
Womöglich gibt es andere Gründe für diese Frustration. Wenn die Rheinsberger möchten, dass für sie vielleicht eine Mehrzweckhalle gebaut wird oder ein Theater und dieses ausbleibt, sie aber dafür wahrnehmen, wie Flüchtlingen Unterkünfte zur Verfügung gestellt werden, kann man vielleicht die Frustration nachvollziehen. Wieso ist Vater Staat für die Fremden da, bevor er sich um das eigene Volk kümmert? Und man beginnt zu begreifen, dass die Frustration in den Bäckereien und Fleischereien über dieses aktive Eingreifen eines Staates den Eindruck verstärkt, „für die anderen“ würde stetig etwas gemacht werden, während „wir“ mit unseren Versicherungen, Apotheken, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Sozialleistungen, Mindestlöhnen immer wieder uns selbst überlassen und „von denen da oben“ vergessen werden. Wer sich allmorgendlich derlei Dialoge anhören muss, beginnt vielleicht irgendwann, diesen Blick zu übernehmen. Doch: Was kommt von nichts? Natürlich und vor allem nicht die Flucht in einem Schlauchboot oder einem Kofferraum. Die kommt durch die Bereitschaft, wirklich alles, auch sein Leben auf Spiel zu setzen. Der Schritt in eines dieser Schlauchboote oder einen dieser Kühllaster muss die am meisten konträre Situation zu den Menschen hier in den ostdeutschen Kleinstädten sein, die in wundervoll renovierten Freilichtmuseen vor sich hin leben, verzagend und verzweifelnd beim halbherzigen Versuch, diese mit und durch Leben zu bespielen. Ich hingegen bin um jeden Flüchtling dankbar der mich verwundert zurück grüßt, der reagiert auf meinen Impuls einerseits und andererseits aus sich heraus agiert und Städte, die so leblos daherkommen wie Rheinsberg, mit Leben erfüllt.
Im Ort spürt man tatsächlich, dass die Flüchtlinge ein Stadtbild verändern können. Denn in Rheinsberg sind genauso wenig Deutsche auf den Straßen, in den Geschäften, selbst in den Apotheken unterwegs wie in den anderen Städten zuvor. Jedoch sieht man hier überall Flüchtlinge beim spazieren, lachen, schimpfen, grüßen, rauchen, telefonieren. Im Schlosspark steht eine vierköpfige Familie, Vater, Mutter, Sohn, Tochter. Sie stehen am Wasser und füttern die Enten, fotografieren sich vor den Vögeln stehend, vor der Schlossfassade, vor dem Marstall. Es wirkt so unglaublich deutsch, wie in einem handgestickten Gobelinbild. Allein: Es ist eine Flüchtlingsfamilie. Sie lebt in einem angrenzenden Haus, das für sie und bis zu siebzig andere Personen zur Verfügung gestellt wurde. Sie werden hier bleiben und die deutsche Provinz auch zu ihrer Lebenswelt wandeln oder irgendwann in ihre Heimat zurückkehren, falls dort einmal kein Krieg mehr toben wird. Wie sie hier stehen im schimmernden Licht des Sees, strahlen sie mehr Frieden aus, als alle Deutschen, die ich in Rheinsberg lamentieren sehe.
Ich habe heute meine erste Ländergrenze überschritten. Plötzlich war Mecklenburg-Vorpommern durchquert und ich stand in Brandenburg. Was hat mir der Norden nun gezeigt? Ich habe einen sanften Tourismus im Winterschlaf erlebt, der ähnlich prägend und alltagsbestimmend ist, wie ich es aus Rügen, Barth, Stralsund, Fischland bereits kannte. Man sieht schicke kleine Städtchen, die von ihren zahlenden Gästen leben, sowie einstürzende kleine Dörfchen, die durch nichts mehr leben, die sich weitestgehend selbst überlassen werden, die voraussetzen, dass man ein Auto besitzt oder in Kauf nimmt, hier ein Einsiedlerleben zu führen. In diesen Orten scheint alles egal, Zeit und Raum sind hier unstete Begriffe, es gibt kein links, es gibt kein rechts, es gibt keine Geschäfte oder Plakate, keine Gasthäuser, keine Gäste. Man hat hier seine Ruhe vor der Gesellschaft, den Nachbarn, dem sozialen Element. Man kann dies mögen oder an der Tristesse zugrunde gehen. Ich bin froh um jede dieser Siedlungen, Ausbauten, Orte, die ich hinter mir lasse, in die ich nie wieder in meinem Leben gehen und nach dem Weg fragen muss.
Ich habe in neun Tagen lediglich ein einziges Polizeiauto gesehen, es war am Beginn der Reise in Rostock. Das wäre ein Eindruck, den ich gerne mal der ganz linken außerparlamentarischen Fraktion berichten würde. Die Sorge in einem Polizeistaat zu leben, scheint zumindest in Mecklenburg-Vorpommern äußerst unangebracht zu sein. Außerdem hätte ich mehr Neonazis erwartet. Bis auf die drei Glatzen in dem Schweriner Bier- und der Reichsflagge im Vorgarten, sowie dem vollends durchgeknallten Kapuzenpulloverträger im Zug nach Rostock habe ich keine offensiv-rechten Symbole und Menschen gesehen, was aber natürlich nur für die zur Schau getragene Oberfläche der Menschen gilt. Schwer zu sagen, wie es mit den Gesinnungen der durch und durch Frustrierten in den Kleinstädten aussieht.
Schwerin, Wismar, Rostock hingegen haben sich als wirklich ansehnliche Städte gezeigt, deutlich hübscher als man sie sich als Wessi ausmalt, wenn man bloß die Namen hört. Schnieke, kleine Geschäftchen, die an den Prenzlauer Berg erinnern, inmitten von wuseligen und unfassbar sauberen Standardfußgängerzonen. Abseits dieser geschäftigen Städte offenbaren sich tote Vororte und Dörfer, deren Lebhaftigkeit ich so im Hinterland der Ukraine vermutet hätte und ich mich frage, wann die Wölfe wieder präsenter als das Gekläffe der wachsamen Hunde sein wird.
–
 Ich kaufe Proviant für den nächsten Tag und quartiere mich im Stadtzentrum ein. Die Schmerzen zwingen mich zu einer schnellen Entscheidung, also ist die erste Pension gerade recht. Ich spüre eine unergründliche Abneigung der Wirtin gegen mich, doch sie und ihre zähneknirschende Ausstrahlung sind mir gleich. Was kümmert mich ihr Blick, schließlich lasse ich gutes Geld bei ihr. Ich lege einen Nachttisch auf mein Bett und schlafe mit angewinkelten Beinen und Rheinsberger Laune ein.
Ich kaufe Proviant für den nächsten Tag und quartiere mich im Stadtzentrum ein. Die Schmerzen zwingen mich zu einer schnellen Entscheidung, also ist die erste Pension gerade recht. Ich spüre eine unergründliche Abneigung der Wirtin gegen mich, doch sie und ihre zähneknirschende Ausstrahlung sind mir gleich. Was kümmert mich ihr Blick, schließlich lasse ich gutes Geld bei ihr. Ich lege einen Nachttisch auf mein Bett und schlafe mit angewinkelten Beinen und Rheinsberger Laune ein.
Die kratzbürstige Wirtin gibt mir am nächsten Morgen vollkommen den Rest und zieht mich hinein in ihre Indolenz. Sie ist ihre eigene Chefin und hasst ihr Leben offenkundig; kein einziges mal schenkt sie mir ein Lächeln oder eine warme Geste. Ich frage mich, wie man so verbittert wirken kann, wenn man doch einen so prägenden Teil seines Lebens – die Arbeit – selbst bestimmen und formen kann. Jede zaghafte Frage von mir beantwortet sie mit dem kurzen Staccato-Hammer eines antwortähnlichen Wortgebildes. Es fällt mir schwer, die Ruhe zu bewahren, Danke und Bitte nicht zu vergessen, das Grinsen nicht zu verschlucken. Nein, du Seelchen, du wirst mich nicht so verbittern wie es dieser Ort bereits versucht hat. Diesen Sieg schenke ich euch nicht, da fliehe ich lieber, schnell und Hals über Kopf und ohne mich nach euch umzudrehen. Und so denke ich nach dem Frühstück: Nur noch weg hier, egal wie. Bus, Bahn, Anhalter, die erstbeste Gelegenheit ist mir die liebste. So stehe ich einige Minuten später an einer Bushaltestelle und warte auf meine Linie. Der Bus ist schnell zu zwei Dritteln mit Flüchtlingen gefüllt, man bekommt eine Lektion in geringer Schmerzempfindlichkeit, was Smartphonegeräusche angeht, hinten, vorne, überall ist Gedudel und Gebimmel zu hören. Was mich überall sonst aufregten würde, werte ich hier als ein lebendiges Zeichen und schaue erstaunt und beeindruckt weiter durch den Bus.
–
Eine junge Frau Anfang zwanzig steigt ein. Die Flüchtlinge haben so jemanden noch nicht gesehen, ich habe so jemanden noch nicht gesehen. Sie ist extrem solariumgebräunt, hat schneeweiß gefärbte Haare und einen in Wolfsfell gehüllten markanten Undercut, der sich quer über ihren Kopf zieht. Ihre „Miami-Nails“-Plastiknägel glitzern und funkeln, sie hat riesige Tunnel in den Ohrläppchen und eine Ansammlung fiesester Tattoos; chinesische Schriftzeichen, Tribals, ein „BRD“-Zeichen am Handgelenk. Der Blick aus ihren huskyblauen Augen ist eisenhart und ohne eine einzige Regung, auch nicht, als sie an der JVA Neuruppin aussteigt.
Die Welt ist so herrlich an mir vorübergezogen, dass ich mir gewünscht habe, die Fahrt würde niemals enden, als wir am Ziel in Neuruppin ankommen. Nun also: Fontane-Stadt. Preußischste aller preußischen Städte. Ein Impuls will mich direkt weiterfliehen, Neuruppin Neuruppin sein und links liegen lassen, womöglich weil es mich so sehr an Rheinsberg erinnert. Doch ich bleibe. Die Sonne scheint und ich sehe alles im besten Licht, die herausgeputzten Häuser und Straßenzüge, garniert mit dieser neunziger Jahre Zweckarchitektur, die sich für modern hielt und doch außer scheußlich und menschenfeindlich kühl nur sehr wenig ist. Arztpraxen und Sozialwohnungen aus dieser Epoche schauen aus, wie ich mir die Albträume von Kandinsky vorstelle. Dazu das Altbekannte: Arbeitsvermittlungen, Physiotherapeuten, Apotheken soweit das Auge reicht. Ich halte bereits mittags Ausschau nach einer Kneipe für den Abend, einen Ort an dem ich einerseits das Dortmund-Spiel sehen und mich andererseits betrinken kann, vorsätzlich, als Mittel um all diesen Frust fortzuspülen, den mir die Orte in den letzten drei Tagen versuchen mit auf den Weg zu geben. Der Gedanke an die immermögliche Flucht, er ist wie ein Anker. Denn was bliebe mir, wenn ich nicht morgens den Rucksack schultern und fort marschieren könnte? Es blieben: Chronischer Alkoholismus. Sich gehen lassen. Protestparteien. Zweifarbige Frisuren. Fiese Tattoos und Klamotten.
Es bliebe: Lethargie.
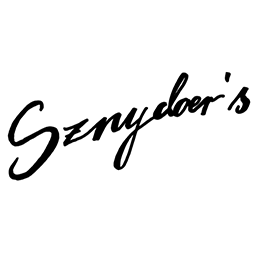



Leave a Reply