RÖBEL – MIROW
–
Die Reise von Röbel nach Mirow ist ein Crashkurs in Entschleunigung. Wenn Warten die sprichwörtlich härteste Arbeit ist, dann ist dieser Tag die zähste und längste Schicht während der gesamten sechs Wochen.
–
Im Zeitlupentempo baue ich mein taunasses Zelt ab und  frühstücke auf dem Campingplatz. Die Brötchen werden aus dem Back-Shop irgendeines Supermarktes geliefert und schmecken leider auch genau so. Was ist da eigentlich genau schief gelaufen mit dem Deutschen Brot? Jahrelanges Pfenniggefuchse und Drücken der ohnehin schon günstigen Lebensmittelpreise führen dazu, dass die Brötchen, Schrippen und Wecke zwar allerorts sechs oder sieben Cent günstiger in den SB-Fenstern bereit liegen, allerdings kaum noch bei einem richtigen Bäcker. Jedes mal wenn ich auf solche Rohlinge wie hier in Röbel beiße, die wie eingeschlafene Füße schmecken und sich wie Schwämme anfühlen, bin ich davon überzeugt, dass durch diese Discounterbackwaren ein Stück der deutschen Alltagskultur, der Identität verloren geht. Verkauft für ein klein wenig mehr Geiz-Ist-Geil-Mentalität; es geht schließlich um Quantität, nicht um das andere. Schade, eigentlich.
frühstücke auf dem Campingplatz. Die Brötchen werden aus dem Back-Shop irgendeines Supermarktes geliefert und schmecken leider auch genau so. Was ist da eigentlich genau schief gelaufen mit dem Deutschen Brot? Jahrelanges Pfenniggefuchse und Drücken der ohnehin schon günstigen Lebensmittelpreise führen dazu, dass die Brötchen, Schrippen und Wecke zwar allerorts sechs oder sieben Cent günstiger in den SB-Fenstern bereit liegen, allerdings kaum noch bei einem richtigen Bäcker. Jedes mal wenn ich auf solche Rohlinge wie hier in Röbel beiße, die wie eingeschlafene Füße schmecken und sich wie Schwämme anfühlen, bin ich davon überzeugt, dass durch diese Discounterbackwaren ein Stück der deutschen Alltagskultur, der Identität verloren geht. Verkauft für ein klein wenig mehr Geiz-Ist-Geil-Mentalität; es geht schließlich um Quantität, nicht um das andere. Schade, eigentlich.
Ich werde heute nicht weit wandern können, das ist mir früh am Morgen bereits klar. Zu sehr schmerzen mir die Sprunggelenke, das Knie, die Schultern. Vor allem die Blasen an meinen Füßen machen mir zu schaffen. Dick und unter Druck und voller Wasser sind die acht Exemplare, mit denen ich seit dem ersten Tag unterwegs bin. Abends steche ich sie mir immer wieder auf und drücke das Wasser heraus, im hohen Bogen kommt es aus den Spritzenköpfen geschossen. Damit verhindere ich ein Reißen und offenlegen der Wunde, aber jeden Abend sind die Blasen aufs Neue gefüllt. Womöglich lag es auch am Saunieren oder der allgemeinen Feuchtigkeit in einem Schwimmbad, jedenfalls schmerzen die Füße an keinem Morgen so sehr, wie an diesem in Röbel. Außerdem war der Marsch Gestern zu stur und zu dumm und heute zahle ich hierfür wieder etwas Lehrgeld. Unvermeidlich nun: Ich muss etwas ändern.
–
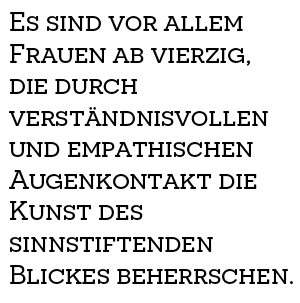 Ich schlürfe also äußerst langsam zurück in das Zentrum von Röbel, wo nur geringfügig mehr Menschen unterwegs sind, als in der Nacht zuvor, in der ich nach dem Thermenbesuch durch ein vollends verwaistes Zentrum zurück zum Campingplatz geradelt bin. Selbst die mir empfohlene Kneipe – „Da ist immer etwas los! Da lohnt es sich auf jeden Fall hinzugehen!“meinte die jenseits von Gut und Böse geschminkte Dame in der Therme auf meine Frage – hatte geschlossen.
Ich schlürfe also äußerst langsam zurück in das Zentrum von Röbel, wo nur geringfügig mehr Menschen unterwegs sind, als in der Nacht zuvor, in der ich nach dem Thermenbesuch durch ein vollends verwaistes Zentrum zurück zum Campingplatz geradelt bin. Selbst die mir empfohlene Kneipe – „Da ist immer etwas los! Da lohnt es sich auf jeden Fall hinzugehen!“meinte die jenseits von Gut und Böse geschminkte Dame in der Therme auf meine Frage – hatte geschlossen.
Ich habe nun ein paar Wege zu erledigen. Bei der Post versende ich ein Paket nach Berlin mit vier Kilogramm nutzlosestem Gepäck: Ein zu dickes Buch, einen Regenschirm, ein Paar Schuhe, in das ich mit meinen geschwollenen Füßen nicht hineinpasse, eine Kaffeetasse, eine Uniklemme als Stativersatz und noch einige weitere Dinge, die Wanderamateure „ganz bestimmt brauchen werden.“ Wieder was gelernt. Fühlt sich direkt besser an ohne diese Dummheiten.
In der Apotheke nebenan besorge ich neue Nadeln zum Aufstechen der Blasen und Mullbinden zum Verbinden der Füße. Dabei vergucke ich mich augenblicklich in die unfassbar attraktive Apothekerin, die mir ein herzzerreißendes Lächeln und ganz viel Freundlichkeit schenkt. Es sind vor allem Frauen ab vierzig, die durch verständnisvollen und empathischen Augenkontakt die Kunst des sinnstiftenden Blickes beherrschen. Es wird für Außenstehende schwer nachvollziehbar sein, wie viel mir eine solche Geste in diesen Wochen bedeuten kann, wenn ich mich hauptsächlich mit der Stille, der Weite und meinen Schmerzen beschäftigt. Denn normalerweise werde ich eher erstaunt, verwundert, argwöhnisch, misstrauisch, verschlossen betrachtet. Das Lächeln der Apothekerin bedeutet mir heute die Welt und wird mich durch den Tag tragen. Man wird ja wohl noch träumen dürfen.
Ich versuche noch erfolglos, ein Reclamheft aufzutreiben und stehe dann vor dem „Zentralen Omnibusbahnhof“ von Röbel. Der nächste Bus nach Mirow fährt in exakt fünfeinhalb Stunden. Ich nehme also den nach Rechlin, der direkt abfährt. In Rechlin steige ich in der Nähe der Touristeninformation aus, wo ich von der Schließung des Baumhaushotels erfahre, in dem ich mich heute gerne einquartiert hätte. Ich trinke in aller Ruhe einen sehr großen Pott Kaffee in einer Supermarktbäckerei und wandere mit meinem Blick zwischen einer erneut sehr attraktiven Verkäuferin und dem ketterauchenden Hähnchenverkäufer vor dem Supermarkt hin und her. Drinnen ist jetzt Schichtwechsel, die Schöne geht, die Schrullige kommt. Draußen ebenfalls Schichtwechsel: Die Kippe wird ausgedrückt und eine Horde Schüler bestellt sich einige Broiler.
Anschließend warte ich zweieinhalb Stunden an einer Bushaltestelle. Da abgeholt werden wo man steht – das ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen, denn es gibt hier keine Sitzmöglichkeit. Und weil stundenlanges Stehen ausgeschlossen bleibt, sitze ich auf dem gepflasterten Bürgersteig. Dafür ernte ich entsprechende Blicke der Passanten, naturgemäß von oben herab. Ich grüße jeden still aber deutlich nickend, kaum jemand grüßt zurück. Mir ist meine Wirkung auf Außenstehende momentan allerdings redlich egal. Mir ist genau genommen alles egal außer der schleichenden Sorge, was ich tun würde, wenn sich meine Füße nicht wieder normalisieren. Das Warten besteht somit aus ersten zweifelnden Blicken auf meine Fremdkörperbeine und einem endlosen Blinzeln in die Sonne. Alles was ich will ist laufen, einfach weiter ziehen, aber mein Körper zeigt mir die Grenzen auf. Es ist der mentale und körperliche Tiefpunkt der Reise, resignierend wünsche ich mir auf einem Sofa zu liegen und eine Serie zu schauen. Stattdessen schaue ich bloß immer wieder ans Ende der Straße in der Hoffnung den Bus zu sehen.
Dieser erscheint tatsächlich irgendwann. Auf deutsche Infrastruktur ist weiterhin Verlass. Der ÖPNV befördert außer mir ein gutes Dutzend Schulkinder in die umliegenden Ortschaften. Und diese Route ist tatsächlich spektakulär kompliziert konzipiert: Zwischen Rechlin und Mirow liegen etwa zehn Kilometer Luftlinie, für die wir über fünfzig Minuten Busfahrt benötigen. Wir setzen ein Kind nach dem anderen in Vororten und Ausbauten ab, die Reise führt uns von Rechlin nach Kotzow, Retzow, Lärz, Krümmel, Troja(!), Buschhof, Schwarz, Strasow (Ausbau), Strasow, Mirow – Wow!

Als wir Mirow endlich erreichen, weiß ich nicht, ob ich darüber nun glücklich sein soll. Der Name Mirow bedeutet soviel wie Frieden oder Ruhe, um die es hier leider nicht weit her ist. Im Minutentakt pressen sich riesige LKW durch die engen Straßen des Heilortes, der irgendwie nicht nach einem solchen aussieht oder riecht. Mit riesigen Plakaten und Schildern fordern die Mirower eine Umgehungsstraße hin zur knapp dreißig Kilometer entfernten Autobahn. Die Häuser an der Hauptstraße sind von den Abgasen dunkel gefärbt, der Lärm schlägt direkt auf das Gemüt. Kein Zweifel, dass man krank wird, wenn man diesem Krach über Wochen, Monate, Jahre ausgesetzt ist.
Ich entscheide mich für ein Gasthaus im Ortskern, das erste meiner Tour. Hotel und Gastwirtschaft unter einem Dach, Frühstück inklusive für 35€. Die Tür des Hotels ist verschlossen, also rufe ich bei der ausgehängten Nummer an. Der Wirt meldet sich und sagt, er werde in dreißig Minuten vor Ort sein, ob ich so lange auf ihn warten könne. Kein Problem. Der komplette Tag bestand aus einem fast lückenlosen Warten. Das wäre doch gelacht, wenn ich diese halbe Stunde nicht noch totschlagen kann. Ich kaufe einen Kaffee und schaue mir an, was auf dem Marktplatz an Leben stattfindet. Zwei Männer in ausgeblichenen Jacken mit dem Logo des örtlichen Fußballvereins trinken wortlos Bier und schauen sich wie ich die Restbestände des vorüberziehenden und nachmittäglichen Lebens an. Vor der Sparkasse stehen vier Raucher und rauchen viel. Smartphones und Zigaretten. Ein junger Mann fährt sein Auto genau vier mal um den Marktplatz und führt dabei jedem, der es wissen oder nicht wissen möchte, seinen Musikgeschmack vor.
Obwohl ich augenblicklich unsagbar glücklich bin, hier nicht zu wohnen, bin ich dann doch ganz froh darüber, hier und heute angekommen zu sein. Ähnlich wie ein Flughafenterminal oder eine Mall, hat dieser zentrale Platz die Ausstrahlung eines recht vollkommenen Nicht-Ortes: Der Körper befindet sich zwar im Hier und Jetzt, allerdings ist der Geist bereits auf Reise an einen anderen Ort oder noch am Verweilen im zuvor besuchten. Momentan sehne ich mir das Bett der Pension herbei.
Dann erscheint der Wirt, fünf Minuten schneller als angekündigt und dementsprechend verschwitzt und gehetzt. Er ist unglaublich höflich zu mir, ich bin sehr dankbar und auch glücklich darüber, mir wohl den richtigen Ort ausgesucht zu haben. Ich verarzte meine Füße auf dem Zimmer während auf ARTE „Die Nacht der Generäle“ ausgestrahlt wird. Na klar, auch das ist Deutschland: Kein Tag, keine Stunde vergeht ohne Nazis im Fernsehen.
–
Mit frisch bandagierten Füßen spaziere ich einige Straßenzüge in Mirow ab, 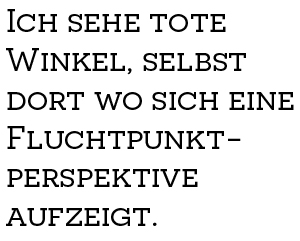 man könnte auch sagen: Ich gehe hinaus ins Nichts. Um den Marktplatz herum liegen nicht weniger als drei Apotheken in unmittelbarer Nähe zueinander (Sonnen-, Linden-, Schloss-), Physiotherapeuten, wohin das Auge blickt. Ein Restaurant teilt durch sehr ausgeblichene Handschrift auf einem Schild in der Tür mit, dass „vorübergehend geschlossen“ sei. Ab Oktober – aber in welchem Jahr? – sei wieder geöffnet. Die aufgeklebten Empfehlungen aus den Reiseführern gehen zurück ins Jahr 2003/04. Zwei sympathisch ausschauende Biergärten haben leider geschlossen. Geöffnet findet man lediglich die Bäckerei mit einer Speiseeistheke vor. Ich sehe tote Winkel, selbst dort wo sich eine Fluchtpunktperspektive aufzeigt.
man könnte auch sagen: Ich gehe hinaus ins Nichts. Um den Marktplatz herum liegen nicht weniger als drei Apotheken in unmittelbarer Nähe zueinander (Sonnen-, Linden-, Schloss-), Physiotherapeuten, wohin das Auge blickt. Ein Restaurant teilt durch sehr ausgeblichene Handschrift auf einem Schild in der Tür mit, dass „vorübergehend geschlossen“ sei. Ab Oktober – aber in welchem Jahr? – sei wieder geöffnet. Die aufgeklebten Empfehlungen aus den Reiseführern gehen zurück ins Jahr 2003/04. Zwei sympathisch ausschauende Biergärten haben leider geschlossen. Geöffnet findet man lediglich die Bäckerei mit einer Speiseeistheke vor. Ich sehe tote Winkel, selbst dort wo sich eine Fluchtpunktperspektive aufzeigt.
Ich bemerke auch, dass ich hier ganz klar ein Fremdkörper bin. Blicke im Rücken, nicht in die Augen sind der Normalfall. Ein junges Paar, das sich rauchend auf die Fensterbank eines an der ohrenbetäubenden Hauptstraße gelegenen Hauses aufstützt, mustert mich scheel durch ihre pinken Haarsträhnen hindurch. Sie reagieren nicht auf meinen Gruß. Ebenso die beiden alten Männer vor einem kleinen Geschäft – auch hier bleibt mein Gruß unerwidert, die Blicke gen Boden geneigt. Pure Verständnislosigkeit in ihren Gesichtern, resignierende Ratlosigkeit bei mir. Ich bin so erzogen worden, dass man grüßt wenn man sich begegnet. Zumindest auf dem Dorf und in Kleinstädten macht dies Sinn. In der Stadt wird man entweder für verrückt oder einen Stalker gehalten, wenn man versucht, jeden zu grüßen. Als Dörfler hingegen wird man geächtet, wenn man seine Mitmenschen nicht mehr grüßt. Nun, da ich alleine in der Provinz unterwegs bin, grüße ich jeden, mit dem ich einen Blickkontakt aufbauen kann, sei er auch noch so flüchtig. Denn prinzipiell bin ich für alle oberflächlichen Gespräche, jeden vergänglichen zwischenmenschlichen Kontakt dankbar, denn es würde die omnipräsente verbale Stille durchbrechen und mich vom Beobachter in den Teilnehmer einer Szenerie verwandeln. Wenn die Willkommenskultur ein Aspekt meiner Tour bleibt, dann sind die lokalen Blick- und Grüßverhältnisse ein guter Messwert für die jeweilige Stimmung auf den Straßen. Hier in Mirow ist es um diese Stimmung sehr schlecht bestellt.
Zwei Teenagerjungs mit blechern schallendem HipHop aus ihrem Smartphone kommen mir auf der gegenüberliegenden Straßenseite entgegen. Sie verstummen, als sie mich erblicken, reden erst weiter, als ich an ihnen vorüber gegangen bin. Werde ich paranoid oder schauen mir die Menschen auf ihren Balkonen hinterher? Ich kann sie nicht sehen, doch ihre tuschelnden Stimmen ganz klar hören. Ich warte nur darauf, dass ein Sheriff oder Marshall vor mir steht und mir, während er seinen Kautabak auf den Boden spuckt, klar und deutlich zu verstehen gibt, dass ich in seiner Stadt keinen Ärger machen soll, während im Hintergrund abgestorbene Äste durch die mecklenburgische Prärie geweht werden.
Der Höhepunkt der Trostlosigkeit, ein Ausdruck für die mangelnde Mobilität in der Provinz im Allgemeinen und in der Stadt Mirow im Speziellen, ist der „Zentrale Omnibusbahnhof“. Dabei klingt ZOB so verheißungsvoll nach Fernreisen und wartenden Rollkofferziehern auf den Steigen, nach Reisebussen und angesteuerten ZOBs in Kiew, Warschau, Paris, Madrid, es klingt nach einem Trip hinaus in die weite Welt. Hier in Mirow jedoch besteht dieser Ort aus zwei holprigen Fahrspuren ohne Licht und die angefahrenen Haltestellen tragen die Namen der ortsansässigen Supermärkte. Die Busse fahren meistens einmal, hin und wieder zweimal pro Tag. Eingeworfene Scheiben in dem Wartehäuschen, dahinter eine offensichtlich seit Ewigkeiten geschlossene Spelunke. Irgendwo wird gegrillt, ansonsten ist es totenstill an diesem zentralen Ort in Mirow.
–
 Hier zu sein ist auf ernüchternde Weise ein erhellendes Erlebnis. Es ist die Atmosphäre eines ostdeutschen Western-Settings, die müden Blicke und desillusionierten Körperhaltungen, wie man sie von den Figuren aus „Erbarmungslos“ kennt. Kein Lachen ist zu hören, keine beschwingte Gangart zu sehen. Man schleppt sich hier durch sein Leben, kapitulierend und scheinbar erwartungslos die Einkäufe oder Kinder hinter sich herziehend. Diese Bushaltestelle zu betrachten schmerzt und bedrückt, sie sagt dem Betrachter: Fort kommst du hier nicht so schnell! Ich stelle mir vor: Ich lebe hier und möchte weg, aber aus welchen Gründen auch immer kann ich es nicht. Vielleicht ist dies meine Heimat und ich hier verwurzelt. Womöglich gehöre ich zu denjenigen, die noch eine Arbeit haben, in den Apotheken oder der Feriensiedlung oder irgendwo im Umland. Vielleicht bindet mich auch die Familie an Mirow. Aber wenn man ahnt, wie sich die weite Welt anfühlen kann, mit ihren Verlockungen, fremden Orten und dem ewig frischen Wind des Neuen und Unbekannten, dann ist Mirow so etwas wie ein Anti-Ort, der sich als das exemplarische Gegenbeispiel eines gesunden, vitalen Ortes fest in mein Bewusstsein einbrennt. Ganz sicher wird es Menschen geben, die gerne in Mirow bleiben möchten. Ich will es niemandem vergönnen oder vor den Kopf stoßen mit meinem nichtigen Geschmack und dem Verständnis eines gesunden Ortes, aber es ist für mich beim besten Willen nicht nachvollziehbar wie man hier lange sein kann, ohne vollends den Verstand zu verlieren oder zumindest die Flinte ins Korn zu werfen. Die LKW, die Apotheken, der marode Bahnhof, die holprigen Straßen und die Sozialbauten mit ihrem Waschbetonanstrichen, die zersplitterte Infrastruktur und die allseits leeren Blicke. Die Atmosphäre übernimmt die Beantwortung der offenen Fragen und macht aus den Menschen diese trostlosen Gesichter, die grußlos aus ihren Fenstern blicken oder rauchend und auf Displays schauend ihre Nachmittage vor der Bank verbringen. Ich schwanke zwischen Ekel und Mitleid, komme mir gleichzeitig erhaben und arrogant vor, wie ich hier stehen kann und diesem Ort sein Zeugnis ausstelle, wohl wissend: Ich kann jederzeit flüchten.
Hier zu sein ist auf ernüchternde Weise ein erhellendes Erlebnis. Es ist die Atmosphäre eines ostdeutschen Western-Settings, die müden Blicke und desillusionierten Körperhaltungen, wie man sie von den Figuren aus „Erbarmungslos“ kennt. Kein Lachen ist zu hören, keine beschwingte Gangart zu sehen. Man schleppt sich hier durch sein Leben, kapitulierend und scheinbar erwartungslos die Einkäufe oder Kinder hinter sich herziehend. Diese Bushaltestelle zu betrachten schmerzt und bedrückt, sie sagt dem Betrachter: Fort kommst du hier nicht so schnell! Ich stelle mir vor: Ich lebe hier und möchte weg, aber aus welchen Gründen auch immer kann ich es nicht. Vielleicht ist dies meine Heimat und ich hier verwurzelt. Womöglich gehöre ich zu denjenigen, die noch eine Arbeit haben, in den Apotheken oder der Feriensiedlung oder irgendwo im Umland. Vielleicht bindet mich auch die Familie an Mirow. Aber wenn man ahnt, wie sich die weite Welt anfühlen kann, mit ihren Verlockungen, fremden Orten und dem ewig frischen Wind des Neuen und Unbekannten, dann ist Mirow so etwas wie ein Anti-Ort, der sich als das exemplarische Gegenbeispiel eines gesunden, vitalen Ortes fest in mein Bewusstsein einbrennt. Ganz sicher wird es Menschen geben, die gerne in Mirow bleiben möchten. Ich will es niemandem vergönnen oder vor den Kopf stoßen mit meinem nichtigen Geschmack und dem Verständnis eines gesunden Ortes, aber es ist für mich beim besten Willen nicht nachvollziehbar wie man hier lange sein kann, ohne vollends den Verstand zu verlieren oder zumindest die Flinte ins Korn zu werfen. Die LKW, die Apotheken, der marode Bahnhof, die holprigen Straßen und die Sozialbauten mit ihrem Waschbetonanstrichen, die zersplitterte Infrastruktur und die allseits leeren Blicke. Die Atmosphäre übernimmt die Beantwortung der offenen Fragen und macht aus den Menschen diese trostlosen Gesichter, die grußlos aus ihren Fenstern blicken oder rauchend und auf Displays schauend ihre Nachmittage vor der Bank verbringen. Ich schwanke zwischen Ekel und Mitleid, komme mir gleichzeitig erhaben und arrogant vor, wie ich hier stehen kann und diesem Ort sein Zeugnis ausstelle, wohl wissend: Ich kann jederzeit flüchten.
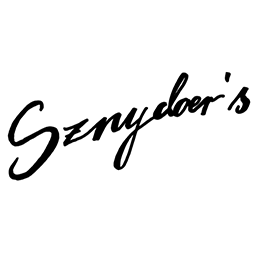



Leave a Reply