JENA – WEIMAR
–

Das Frühstück am Campingplatz unter dem Jenzig war erneut eine kleine kulinarische Offenbarung. Der Abschied ferner herzlich, und in die bereits stechende Sonne hinein breche ich von dort aus auf in Richtung Hochkultur. An Jenas Stadtrand werde ich ungläubig angestarrt, als ich mich nach dem Weg in Richtung Weimar erkundige. Ein junger Jogger hebt, halb zweifelnd, halb beeindruckt seine Augenbrauen und weist mir die Richtung. Eine alte Russin hält mich für verrückt, „bei dem Wetter! Heiland! Machen sie es bloß nicht!“ Es ist, als versuche Jena mich festzuhalten und noch einen weiteren Tag an sich zu binden.
Der Schweiß rinnt über meinen Körper und ich spüre wie mir die Haut errötet. Die Gangart Querfeldein über die Hügel und durch die Wiesen – wie es mir der Mann im Feld während meiner ersten Rast nahe gelegt hat – ist eine späte Entdeckung: Ich laufe ins offene hinein und wie losgelöst von den Fesseln der umwegigen Wege, durch oberschenkelhohes Gras und undurchsichtige Waldstücke wühle ich mich auf Weimar zu. Am Horizont kann ich Buchenwald bereits wie einen dunklen Leuchtturm ausmachen. Geradeausstimmung. Naive melody: Ich singe weite Teile des Weges, nein, ich brülle in die menschenleeren Felder und Weiten hinein, The Brian Jonestown Massacre, Gang of Four und immer wieder die Talking Heads und das LCD Soundsystem. I dance myself clean.
–
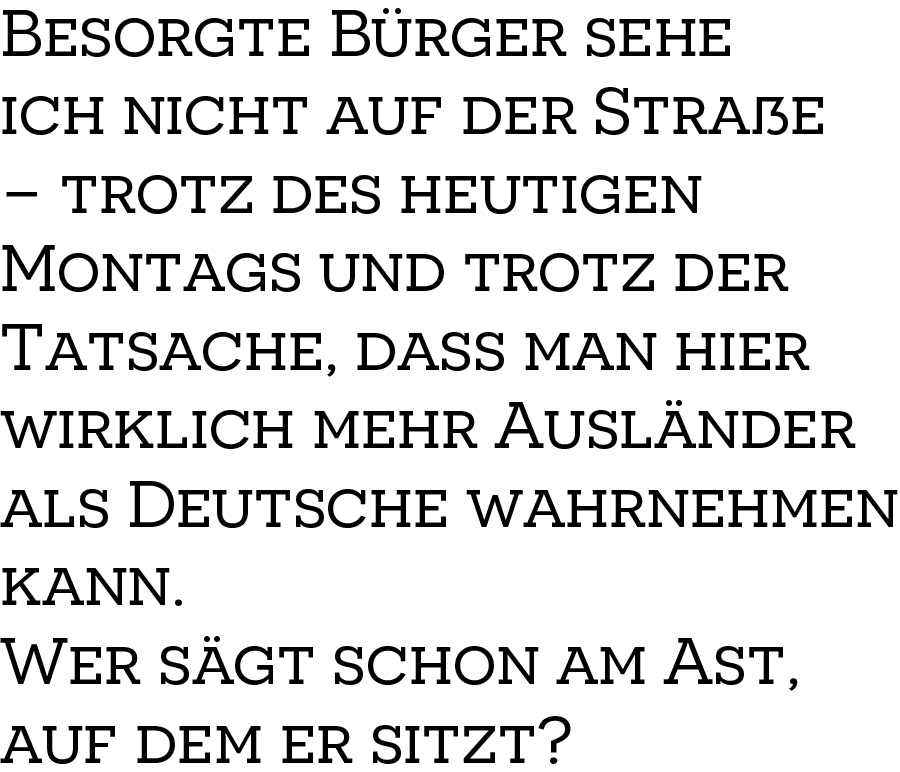 Der Lutherweg, auf dem ich die zweite Hälfte der Tagesroute laufe, geht nahtlos in eine Parkanlage über und diese spuckt mich direkt am Weimarer Markt aus. Sehr schnell ist klar: Die Stadt gehört zum Tafelsilber der Republik – und sie ist sich dessen sehr bewusst. Vorzeigestadt, gute Stube, Klassik, Goethe, Schiller, Wieland, Herder, Bach, Cranach, Liszt, Nietzsche, Bauhaus, Weimarer Republik und leider, natürlich, Buchenwald. Nirgendwo scheinen Klassik und Konzentrationslager so nahe beieinander zu liegen wie hier. Mein erster Weg führt mich in die Touristeninformation, wo man um die kommerzielle Ausschlachtung dieses Kontrastes wenig verlegen scheint. Neben Goethe-Porzellan und weiteren klassischen Mitbringseln werden Buchenwald-Andenken angeboten. Die Verkaufsstelle ist sozusagen zweigeteilt; vorne findet man die Klassik, hinten den Horror. Alles unter einem Dach, in einem Raum, in einer großen Regalkonstruktion. Hindurch wuseln die Schulgruppen, ihre Lehrer und alle weiteren Gäste und zucken unentwegt ihre kleinen Digitalkameras.
Der Lutherweg, auf dem ich die zweite Hälfte der Tagesroute laufe, geht nahtlos in eine Parkanlage über und diese spuckt mich direkt am Weimarer Markt aus. Sehr schnell ist klar: Die Stadt gehört zum Tafelsilber der Republik – und sie ist sich dessen sehr bewusst. Vorzeigestadt, gute Stube, Klassik, Goethe, Schiller, Wieland, Herder, Bach, Cranach, Liszt, Nietzsche, Bauhaus, Weimarer Republik und leider, natürlich, Buchenwald. Nirgendwo scheinen Klassik und Konzentrationslager so nahe beieinander zu liegen wie hier. Mein erster Weg führt mich in die Touristeninformation, wo man um die kommerzielle Ausschlachtung dieses Kontrastes wenig verlegen scheint. Neben Goethe-Porzellan und weiteren klassischen Mitbringseln werden Buchenwald-Andenken angeboten. Die Verkaufsstelle ist sozusagen zweigeteilt; vorne findet man die Klassik, hinten den Horror. Alles unter einem Dach, in einem Raum, in einer großen Regalkonstruktion. Hindurch wuseln die Schulgruppen, ihre Lehrer und alle weiteren Gäste und zucken unentwegt ihre kleinen Digitalkameras.
Wieder draußen vor der Tür stehe ich erstmal ziemlich verloren inmitten von unüberschaubaren und ungehalten durcheinander wuselnden Touristengruppen und Stadtführungen, Amerikaner, Asiaten, Franzosen, dazu Marktschreier, Couponsverkäufer, Nippes und Tinnef, touristische Allerweltsverlockungen. Alle hier sind unterwegs unter Fremden. Es sind die fremden Besucher aus dem „Westen“, also dem westlichen Kulturkreis, Asien natürlich noch, die gerne gesehenen Besucher, die chicen und wohlhabenden Ausländer also. Sie lassen ihr Geld gerne hier, weil sie Geld besitzen und sind dann schnell – hoffentlich! – wieder fort, weiter gezogen in Richtung der anderen deutschen Ziele; Dresden oder Berlin oder München. Angst vor einer Überfremdung, einer touristischen Überfremdung des Abendlandes, scheint hier dennoch niemand zu haben.
Alle zwei Meter stehen verirrte und verwirrte Menschen und fragen einheimisch wirkende nach den Wegen, mit den Fingern auf Stadtplänen oder digitalen Kartendiensten entlang tastend. Aha, ja, danke, bitte, goodbye, enjoy your stay. Es muss eine Zäsur für die Weimarer sein, auf engstem Raum und zwischen all diesen Touristen und Besuchern zu leben und zu funktionieren, dabei zu versuchen die eigene Identität zu bewahren. Wobei es hier mit der Identität eine merkwürdige Angelegenheit zu sein scheint, denn auch die verlässlichen Instanzen richten sich ganz auf die selbstbewusst, bis elitär hoch getragene Nase der Stadt aus: Die Buchhandlungs- und Drogerieketten verzichten auf ihre Hausfarben und präsentieren sich mit goldenen Schildern. Studenten in makellosen Anzügen kreuzen die penibelst gepflegten Wege. Der Preis für Kaffee und Kuchen ist deutlich höher als in anderen Städten. Bildungsreisende wohin man schaut, dafür kaum Funktionskleidung. Es ist ein vollends anderer Tourismus, den ich in Weimar sehe.
Ich gehe eine obligate erste Runde mit Gepäck durch die Innenstadt und nehme mir ein Hotel im Zentrum, wo ich meine Sachen ablege und zurück zum Markt schlendere um etwas zu Essen und die Menschenmassen weiter auf mich wirken zu lassen. Drei jugendliche Franzosen kommen zu mir und schnorren sich einige selbstgedrehte Zigaretten. Es ist ihr erster Tag aber es gefällt ihnen blendend. Klar, was sollen sie sonst sagen? Sie sind unterwegs in einem anderen Land, die Welt gehört ihnen, niemand hier versteht sie: Es ist die pure Freiheit. Hinter mir sitzt die umgekehrte Version dieser Art von Freiheit. Ein älteres Pärchen telefoniert im breitesten Bayerischen Tonfall mit der Tochter oder dem Sohn und breitet sein leutseliges Geltungsbedürfnis über den Marktplatz aus. Das Empfinden von Bescheidenheit ist ihnen vollends fremd, ihre Stimmen entsprechen ihren Körpermaßen, der Gesprächsinhalt ihrer überheblich wirkenden Gestik, wie sie mit salopp dahingeworfenen Handzeichen die Bedienung kommandieren, wie sie am Telefon gebrüllt Noten verteilen an alles Gesehene und Erlebte oder an „den Schlag Mensch“ den sie kennen gelernt haben, und wie froh sie darüber sind, dies alles bald wieder hinter sich lassen zu können und „ins scheene Bayern“ zurückzukehren. Sympathisch sind hier andere, aber Wahrhaftigkeit, das muss ich ihnen lassen, verkörpern sie in jeder Geste und jedem Wort. Und damit und dadurch wirken auch sie frei, obwohl ich sie nicht leiden kann und froh bin, als sie das Lokal dann wirklich und endlich verlassen und sich mit gewatschelten Schritten ihrem Bayern annähern. Ich schlage die entgegengesetzte Richtung ein.
Dort sehe ich ein besetztes Haus oder ein alternatives Zentrum. Davor stehen zwei junge Männer in szenetypisch schwarzer Kleidung aber mit irgendwie opportunistisch anmutenden Nike-Sneakern. Klar, da ist man zunächst einmal moralisch und tendenziell dagegen, gegen so einen kapitalistisch-globalistisch-ausbeuterisch ausgerichteten Konzern. Und dann merkt man, dass der Swoosh! am eigenen Fuß doch irgendwie ganz ansehnlich daherkommt.
Kein einziges hässliches Haus kann ich hier in der Innenstadt entdecken. Alles ist in sich stimmig und wie aus einem Guss, zu schön um wirklich wahr oder eben wahrhaftig zu sein. Und so gehe ich und so geht es pausenlos weiter: An der Musikhochschule sehe ich zierliche Mädchen mit wehenden Haarmähnen, die riesige Instrumente durch diesen restaurierten Substanztraum wuchten. Aus den Fenstern dringt klassische und filigrane Musik hinaus auf die Plätze, die von der tief stehenden Nachmittagssonne erleuchtet werden. Denkmäler und Statuen, Prunk und Gloria soweit die Augen reichen.
Es verschlägt mich in den Ilmpark, der dem ohnehin glänzenden Eindruck und der makellosen Wirkung der Stadt eine kleine Krone aufsetzt. Sind Stadtparks generell eine Oase der Ruhe und der Schönheit, inmitten von oft menschenfeindlich angelegten Straßenzügen, so wirkt der Weimarer Park wie ein Best-Of aus sämtlichen Landschaftsdesign- und Landlust-Zeitungen zwischen 1800 und heute. Er ist von bestechender Schönheit. Ort gewordene Andacht und Besinnlichkeit.
Und plötzlich stehe ich vor Goethes Gartenhaus. Erst Schillers Laube in Jena, nun Goethes Datscha hier in Weimar – beides wie so oft: Ungeplant. Ich denke, dass dies kein schlechter Ort sein kann, um eine Reise zu beenden, über die ich anschließend einen Text schreiben möchte. Ich lasse also den Weg Weg sein und suche mir ein Restaurant für die letzte Mahlzeit.
So ende ich erneut am Marktplatz, wo ich mehrfach überrascht werde. Zunächst falle ich mal wieder auf Äußerlichkeiten hinein. Meine Bedienung schaut aus, als könnte sie die beste Freundin von Beate Tschäpe sein. Ich stecke sie in die optische PEGIDA-Schublade bevor sie überhaupt ein Wort sagen kann und bemerke bei ihrem ersten Satz, an der Art wie sie die Gäste umsorgt, an ihrem ungespielt wirkenden Grinsen, dass sie mit gehörigem Abstand die freundlichste und zuvorkommendste Bedienung der vergangenen sechs Wochen ist. Zudem serviert sie mir die allerbeste Ofenkartoffel, die ich jemals gegessen habe. Es ist sicherlich eine unbedeutende Randnotiz und mag zudem lediglich ein subjektiver Eindruck sein, aber nach zehn oder zwölf Ofenkartoffeln, die ich in den neuen Bundesländern bestellt und verspeist habe, kann ich mir hier ein einigermaßen verlässliches Urteil erlauben. Ich bin begeistert.
–

–
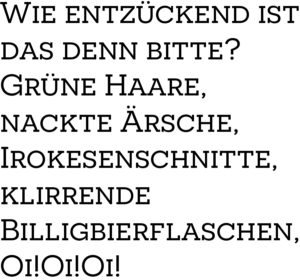 Und noch euphorischer werde ich, als ich direkt neben mir auf dem Marktplatz eine kleine Gruppe Punks nicht überhören kann, die unmittelbar blank ziehen und Arschbomben in den ornamentierten Marktplatzbrunnen werfen. Wie entzückend ist das denn bitte? Grüne Haare, nackte Ärsche, Irokesenschnitte, klirrende Billigbierflaschen, Oi!Oi!Oi!-Gegröhle. Plakativer kann man sich nicht punkig verhalten und dafür möchte ich sie alle einmal herzen, wie sie da mit ihren baumelnden Pimmeln und versoffenen Stimmen auf dem Marktplatz dieser zum Verzweifeln schönen Stadt stehen und den stumpfen Bürgerschreck verkörpern. Das evolutionäre Ende der Egaligkeit, in Weimar geht es baden.
Und noch euphorischer werde ich, als ich direkt neben mir auf dem Marktplatz eine kleine Gruppe Punks nicht überhören kann, die unmittelbar blank ziehen und Arschbomben in den ornamentierten Marktplatzbrunnen werfen. Wie entzückend ist das denn bitte? Grüne Haare, nackte Ärsche, Irokesenschnitte, klirrende Billigbierflaschen, Oi!Oi!Oi!-Gegröhle. Plakativer kann man sich nicht punkig verhalten und dafür möchte ich sie alle einmal herzen, wie sie da mit ihren baumelnden Pimmeln und versoffenen Stimmen auf dem Marktplatz dieser zum Verzweifeln schönen Stadt stehen und den stumpfen Bürgerschreck verkörpern. Das evolutionäre Ende der Egaligkeit, in Weimar geht es baden.
Ich sehe die Punks zwei Stunden später wieder, als ich meine Tagesnotizen im Außenbereich einer piekfeinen Bar schreibe, in der geschniegelte Studenten von ihren Eltern zum Essen eingeladen werden und Kulturschaffende am Nebentisch ihr kulturelles Schaffen wortgewandt ausbreiten. Die Punks haben sich ein kleines Katz-und-Maus-Spiel mit der örtlichen Polizei geliefert, ich habe sie beim Debattieren mit den Beamten beobachten können, als ich zuvor auf der Suche nach einer Bar oder einem Biergarten durch die Nebenstraßen gestreift bin. Der Dicke von ihnen war in eine Diskussion verstrickt, die er extrem selbstsicher geführt hat. Seine Körpersprache war eine einzige Kampfansage. Unbeirrbar und mit breiter Brust stand er da Auge in Auge mit dem Polizisten, seinen angemalten und durchlöcherten Körper unmittelbar vor dem Bügelstreifenbeamten aufbauend, sein Hass auf die Polizei drang ihm aus jeder Pore. Dann lachte er den Beamten aus. Der Grünhaarige hingegen flüchtet später hinter die Bar und liefert sich einen lautstarken Kotzwettbewerb mit dem Punk-Girl aus seiner Gruppe. Die Reaktionen der Bargäste schwanken zwischen erstaunter Heiterkeit und blasiertem Ekel. Und während ein um jede Etikette bemühter Kellner mir einen überteuerten Whisky serviert, beobachte ich die Punks, wie sie gegen die Hauswände kotzen und anschließend ihre tätowierten Beine in die Hand nehmen um vor der Polizei zu flüchten.
Was wäre die Schönheit ohne die Notwendigkeit des Kontrastes?
Kitsch und Scheiße, in Weimar sind sie mein letzter Eindruck dieser Reise.
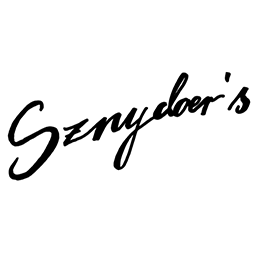


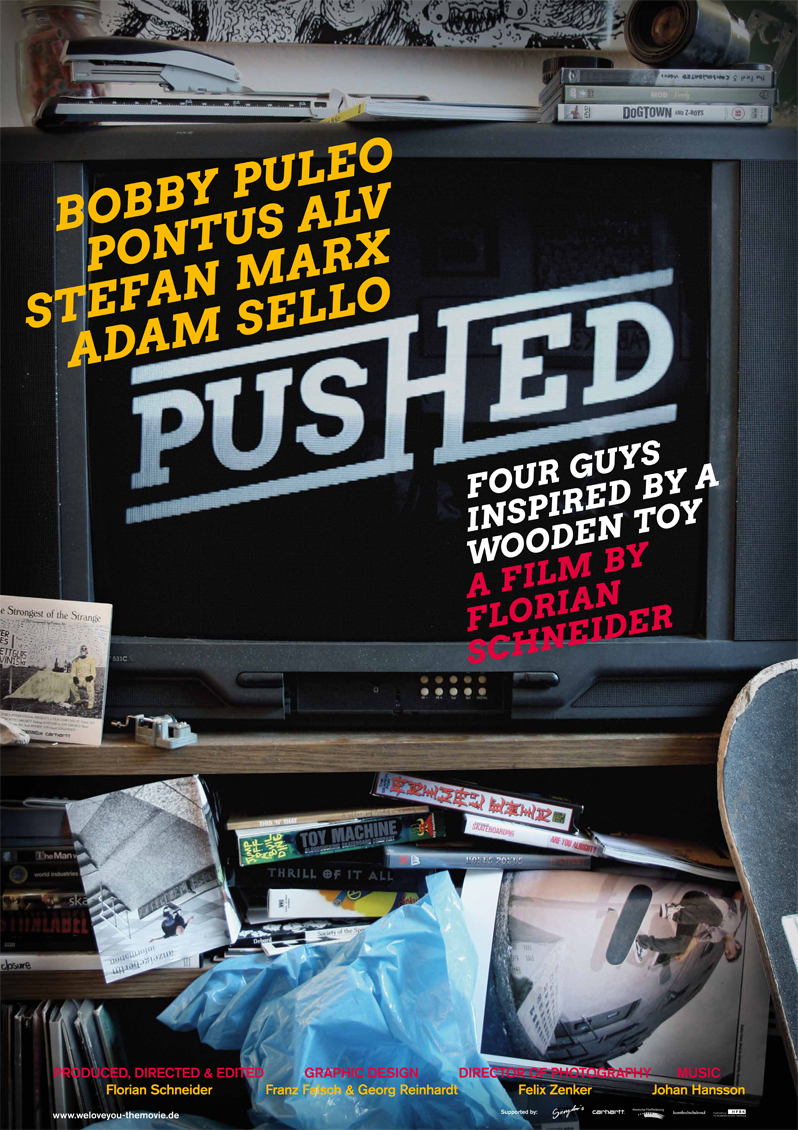
Leave a Reply