JENA
–

Es klingt, als werde ich von einem ganzen Geschwader Vögel geweckt. Ganz sicher wird aber die kecke Drossel unter ihnen sein, die gestern bereits mehrfach versucht hat unter mein Zelt zu hüpfen. Ein Vogel landet auf meiner Unterkunft, während ich noch darin liege. Ich sehe im Wind rauschende Blätterschatten an meiner Zeltinnenwand. Schon vor dem ersten Blick aus dem Zelt heraus verspricht der Tag ein schöner zu werden.
Das Frühstück am Campingplatz ist ausgezeichnet, Joghurt mit Obst, Müsli und Honig, ein nahezu vollkommenes Rührei mit Vollkornbrötchen und cremigen, starken Kaffee. Ich habe einen kompletten Tag ohne einen Plan, ohne Ansprüche und Mindestleistungen vor mir liegen. Ich könnte alles ruhig angehen lassen – also renne ich los, hinauf auf den Jenzig.
Trotz der beachtlichen Steigung gehe ich sehr zügig und überhole die meisten anderen Wanderer – zum Großteil Rentner und Pensionäre – keuchend und einsilbig. Doch auch ich werde noch von einem Jogger abgehängt, der den Berg hinauf sprintet und mir auf seinem Weg hinab erneut entgegen gerannt kommt, bevor ich die Spitze überhaupt erreicht habe. Selbstmörderisch wirkt das und dazu ziemlich beeindruckend.
Eine ältere Dame spricht mich auf meinen Stock an, auch sie stützt sich während des steilen Aufstiegs auf einen gefundenen Ast. Wir wechseln ein paar Worte und dann sagt sie, dass sie mich nicht aufhalten möchte auf meinem Weg. Ich gehe also wieder schneller, doch kaum befinde ich mich einen Meter vor ihr, redet sie wieder weiter. Schließlich teile ich ihr Tempo und begleite sie bis hinauf zum Gipfel. Ich erkläre ihr, warum ich durch den Osten wandere und sie ist wirklich enttäuscht von mir, weil ich die Kernkraft nicht als eines meiner Motive nenne. Ihr Sohn habe sein ganzes Leben dagegen gekämpft, so Leute wie mich würde dies ja nicht mehr interessieren. Meine Meinung, dass es heute gesellschaftlich einschneidendere Probleme gäbe, als der beschlossene und in meinen Augen goldrichtige Ausstieg aus der Kernenergie, ist für sie bloß ein Vorwand. Tatsächlich wirkt sie sogar etwas beleidigt. Ich komme nicht umher, sie auf die Lethargie in weiten Teilen des Ostens anzusprechen: „Ja, wir haben nun mal den Krieg verloren.“ Sie spricht vom Kalten Krieg und eigentlich betont sie es wie einen Vorwurf. Ich gebe mir wirklich Mühe mit ihr, was habe ich ihr denn bitte getan? Sie ist Wissenschaftlerin gewesen, eine Frau der Kausalität und der in Stein gemeißelten Argumente und Formeln. Doch im Gespräch mit mir argumentiert sie auf emotionale Art und Weise – nämlich mit dem diffusen Hebel der Nostalgie. Ich dringe nicht zu ihr durch – wenn ich von Flüchtlingen spreche, redet sie von gestohlenen Statuen und Repressionen gegen Künstler zur DDR-Zeit. Spreche ich dann über die Freiheit der Kunst, fängt sie wieder mit ihrem Sohn an. Einen Konsens können wir nicht finden. Ich bin froh, als wir gemeinsam den Gipfel erreichen und damit aufhören, aneinander vorbei zu reden.
–
 Mit dem Reden – mehr noch: Mit dem Verstehen – ist es auf dem Jenzig heute generell nicht sehr weit her, denn die dreißig Mann und Frau starke Blaskapelle hat soeben begonnen zu spielen. Der Biergarten ist ein Panoptikum aus Lodenjacken, Lederhosen, Wanderstöcken und -hüten, Edelweißfolklore und natürlich Dirndln und Bauernzöpfen, dazu werden Bratwürste und frisch Gezapftes gereicht. Abgesehen von den Bedienungen im Biergarten bin ich hier mal wieder der mit Abstand jüngste vor Ort. Mein Stock fängt einige Blicke und ich kann nicht sagen, ob diese eher respektierend anerkennender oder befremdlich verwunderter Natur sind. Wie ist das nun hier mit meiner Kredibilität als Wanderer? Gelte ich unter den lebenslänglich Wandernden als verkappter Poser? Kann ich mich noch mehr assimilieren? Da hier wirklich ausnahmslos jeder Bier trinkt, ist dies doch ein weiterer Schritt hin zu einer Verbrüderung und Verschwesterung mit den Anwesenden. Gesagt, getan. Genau genommen ist dies der erste wirklich offizielle Frühschoppen meines Lebens und es fühlt sich hier, in die Sonne blinzelnd, mit zuckend-pulsierenden Muskeln nach dem Aufstieg, und dem Lohn des beeindruckenden Panoramas alles andere als verwerflich an. Die Rentner an meinem Tisch stoßen an, einer sagt zu sich selbst „Ach, das ist was feines!“ und ich denke, Mensch, Recht hast du! Dennoch stößt niemand mit mir an. Ich suche den Augenkontakt, bleibe aber der Sonderling. Wie ein Spion, der von einer anderen Generation beauftragt wurde, zu überprüfen was „die Alten“ so am Sonntag treiben. So in etwa komme ich mir vor. Wenn mir jetzt einer auf die Schultern klopfen und anbieten würde, mich an ihren Tisch zu setzen: Man müsste einen Muli ordern, der mich Abends wieder hinab tragen würde. Doch die kumpeligen Gesten bleiben aus. Ich schaue in viele Augen, doch alle wenden sich ab. Merkwürdiges Miteinander.
Mit dem Reden – mehr noch: Mit dem Verstehen – ist es auf dem Jenzig heute generell nicht sehr weit her, denn die dreißig Mann und Frau starke Blaskapelle hat soeben begonnen zu spielen. Der Biergarten ist ein Panoptikum aus Lodenjacken, Lederhosen, Wanderstöcken und -hüten, Edelweißfolklore und natürlich Dirndln und Bauernzöpfen, dazu werden Bratwürste und frisch Gezapftes gereicht. Abgesehen von den Bedienungen im Biergarten bin ich hier mal wieder der mit Abstand jüngste vor Ort. Mein Stock fängt einige Blicke und ich kann nicht sagen, ob diese eher respektierend anerkennender oder befremdlich verwunderter Natur sind. Wie ist das nun hier mit meiner Kredibilität als Wanderer? Gelte ich unter den lebenslänglich Wandernden als verkappter Poser? Kann ich mich noch mehr assimilieren? Da hier wirklich ausnahmslos jeder Bier trinkt, ist dies doch ein weiterer Schritt hin zu einer Verbrüderung und Verschwesterung mit den Anwesenden. Gesagt, getan. Genau genommen ist dies der erste wirklich offizielle Frühschoppen meines Lebens und es fühlt sich hier, in die Sonne blinzelnd, mit zuckend-pulsierenden Muskeln nach dem Aufstieg, und dem Lohn des beeindruckenden Panoramas alles andere als verwerflich an. Die Rentner an meinem Tisch stoßen an, einer sagt zu sich selbst „Ach, das ist was feines!“ und ich denke, Mensch, Recht hast du! Dennoch stößt niemand mit mir an. Ich suche den Augenkontakt, bleibe aber der Sonderling. Wie ein Spion, der von einer anderen Generation beauftragt wurde, zu überprüfen was „die Alten“ so am Sonntag treiben. So in etwa komme ich mir vor. Wenn mir jetzt einer auf die Schultern klopfen und anbieten würde, mich an ihren Tisch zu setzen: Man müsste einen Muli ordern, der mich Abends wieder hinab tragen würde. Doch die kumpeligen Gesten bleiben aus. Ich schaue in viele Augen, doch alle wenden sich ab. Merkwürdiges Miteinander.
–
Derweil dreht sich der Spießbraten. Die Gesinnung hier oben scheint diplomatisch ausgedrückt eine eher traditionelle und konservative zu sein. Kein einziger MiMiMi ist hier oben zu finden in diesem deutsche Brauchtumsammelsorium. Wie isoliert würden diese sich hier fühlen? Ich stelle mir ein schwarzes Pärchen hier oben vor oder eine libysche Großfamilie, deren Sonntagsspaziergang unvermittelt auf dem Jenzig enden würde. Das gäbe dann wohl ein großes Hallo, aber wahrscheinlich recht nonverbal.
Am Wirtshaus ist eine hölzerne Tafel angebracht. Darauf liest sich ein Spruch, der mir sehr sympathisch ist:
–
„Du glaubst der Wand’rer sei ein Sünder,
weil selten er zur Kirche geht.
Im grünen Wald ein Blick zum Himmel
ist besser als ein falsch Gebet.“
–
Eine halbe Stunde Blaskapelle genügen mir – ich habe noch nicht genug gesehen, wohl aber gehört. Auf dem Weg hinab bemerke ich wieder so etwas wie einen Generationenkonflikt. Von gut fünfzig Menschen, die mir entgegen kommen, ernte ich lediglich ein einziges Lächeln einer älteren Dame, werde kein mal von anderen gegrüßt sondern bekomme auf mein „Guten Morgen!“ oft nur ein schroffes „Tach!“ oder „Moin!“ zurück. Ich dachte wir sind jetzt alle Wanderer – wo bleibt der Solidarisierungsgedanke? Nach und nach verliere ich die morgendliche Stimmung in meiner Begrüßung. Als ich wieder den Fuß des Jenzigs erreiche, begrüße auch ich jeden nur noch mit einem geraunt-gebellten „Tach!“
Es sind die Blicke der Menschen, die mich mit in die Tiefen ihrer Ausstrahlung ziehen können. Ich gehe unbekümmert davon aus, dass es einen Schulterschluss unter Kollegen und Gleichgesinnten gibt. Deshalb grüßen sich Busfahrer, wenn ihre Busse aneinander vorbei fahren, deshalb winkt jeder Motorradfahrer dem nächsten und jeder Skateboarder wirft dem anderen eine möglichst coole Handbewegung zu. Ziemlich gutgläubig ging ich davon aus, dass sich also jeder, der „unterwegs“ ist, einander grüßt. Eine Frage der Kinderstube, des Anstands und des Benimms. Es bleibt jedoch über Wochen hinweg eher eine Ausnahme. Vielleicht liegt es an einer deutschen Mentalität. Gelten wir als gastfreundlich? Sind wir ein offenes Volk? Schauen wir optimistisch auf das Neue, auf den Nächsten und das Fremde? Oder hegen wir Angst und Missgunst „den anderen“ gegenüber? Früher empfand ich das amerikanische „Hey, how are you?!“ als eine oberflächliche Zumutung. Heute drückt mein Blick genau diesen Satz aus, suchen meine Augen den aufgeschlossenen Blick eines anderen Reisenden, nur um eben jene Worte zu fragen. Dass diese Blicke und derlei Begrüßungsfloskeln mir gegenüber fast ausschließlich ausbleiben, verbittert mich immer wieder.
Für mich drückt dies vor allem einen Mangel an Selbstsicherheit aus. Wer im Reinen mit sich selbst ist und weitestgehend sorgenfrei durchs Leben zieht, grüßt verhältnismäßig gerne, häufig und vorbehaltlos. Das wäre nun ein Erkenntnisgewinn dieser Reise. Jetzt sind Deutsche, die sich vor allem durch Selbstsicherheit definieren, generell nicht immer ein Glücksfall für die europäische Geschichte gewesen. Aber so ein klein wenig mehr Zuversicht und Unbefangenheit würde ihm gut stehen, „dem Deutschen“.
Kurz nachdem die Sonne am höchsten steht, habe ich das Gefühl, vorerst genug gelaufen zu sein. Ich höre damit auf, meinen Körper auf der Suche nach Eindrücken durch Jena zu drücken und tue etwas was ich seit knapp sechs Wochen nicht getan habe: Ich kaufe mir eine Zeitung. Mit dieser lege ich mich an das Ufer in Paradies und lese beinahe jeden Artikel, sogar die aus dem Wirtschaftsteil. Genauer: Ich sauge sie in mich auf. Das Weltliche streckt seine Fühler aus, die Wehleidigkeit über das nahende Ende der Reise weicht einer Neugier auf alles was jenseits von Entfernungstafeln und Blasenpflastern auf mich wartet oder erlebt werden möchte. Mit dieser Neugier entsteht ein soghaftes Verlangen: Ich phantasiere von einem üppig gefüllten Kühlschrank, der mir die freie Wahl lässt, mit seinem Inhalt alles mögliche zu basteln und zu kochen. Ich sehe endlose Aneinanderreihungen von Tabs gefüllt mit Newsfeeds, Eilmeldungen, Statistiken, Tortendiagrammen, Interviews, Kommentaren, Meinungen, Austausch, Diskurs. Von mir aus dürfen sogar Katzenvideos gespielt werden, ich würde heute alles liken. Ich sehne mich nach einem drückend-pulsierenden Bass und Menschen, die sich sinnlich bis ekstatisch dazu bewegen. Freunde möchte ich nun um mich haben, statt Fremde denen das Grüßen bereits zu mühsam scheint. Sonntag, Sonnenschein, keine Termine, aber auch keine guten und bekannten Menschen – ich ersticke plötzlich in Wehleidigkeit und Sehnsucht.
–

–
Plötzlich fehlt mir Berlin ganz schmerzlich und ich breche wieder auf, um das Einnisten eines unwohlen Gefühls durch das stetige Laufen zu unterdrücken, wie es in den vergangenen Wochen meistens funktioniert hat. Die Bewegung hilft auch heute, allerdings nur solange ich sie aufrecht erhalte. Sobald ich raste und die Fassaden nicht mehr an mir vorüberziehen, legt sich dieser sehnsüchtige Schatten erneut über mein Gemüt. Das Beobachten der Menschen fällt mir nun schwer. Nicht mehr neugierig, sondern vor allem neidisch schaue ich sie an: Ähnlich wie in Leipzig vermisse ich die Nähe zu ihnen. Langsam habe ich genug von meiner Rolle als Sonderling und Fliege an der Wand.
Ich ende wieder auf einem Baumstamm in Paradies. Am Fluss sitze ich und starre auf die Strömung, als direkt vor mir ein Eichelhäher auf einem Ast landet. Er macht in den nächsten vierzig Minuten absolut nichts. Er springt nicht und er fliegt nicht weg. Er macht sich weder sauber, noch macht er den Anschein, nach Futter Ausschau zu halten. Sein Blick bleibt stur nach vorne gerichtet. Er ist einfach nur für sich, sitzt auf diesem Ast vor mir und starrt mich an. Ich kann sogar aufstehen, mich ihm nähern und ihn fotografieren, ohne dass er sich regt. Er ist mir ein Vorbild und unerreichtes Beispiel an Ruhe, Ausgeglichenheit, Seelenfrieden, Gelassenheit. Als er schließlich doch fort fliegt, tue ich es ihm gleich und breche zu einer letzten Runde durch diese Stadt auf, die nun den Studenten gehört, die ihre Rollkoffer durch die Gegend schieben, zurückkehrend von Wochenenden bei ihren Familien, Freunden, Kurzurlauben. Das Rattern ist omnipräsent, nervtötend und erfüllt die Straßen mit einem sonderbaren, unsteten Leben. „No more Rollkoffer“ rufe ich mir ein Berliner Graffiti vor mein inneres Auge.
–
![]() Meine letzte Station in Jena ist vermutlich inspiriert durch die akute Berlinsehnsucht: Es ist ein sehr szeniges Burgerrestaurant, stimmige Einrichtung aus Europaletten und alten Obst- und Weinkisten, modern designte Speisekarten mit Vintageelementen, Burger mit selbst gebackenen Brötchen und Avocadocreme. Ich trinke hier lediglich etwas und werde dafür etwas irritiert angesehen, was mich wiederum verwundert, denn immerhin steht neben der Aufschrift „Restaurant“ auch „Bar“ an der Scheibe geschrieben. Menschen anschauen kann ich hier vorzüglich, vor allem die hübschen, die Studenten, diejenigen die sich chic (aber um Gottes willen nicht zu chic!) machen, um einen Burger und Fritten zu essen. Ich halte mein Fähnlein hier in eine Berliner Brise, es bleibt oberflächlich aber stillt meine Sehnsucht nach dieser geliebt, gehassten Hipsterbohème. Macht man es sich nicht recht einfach, fast schon zu leicht, wenn man sagt, diese Übercoolnes wäre typisch für Berlin und nur dort zu finden? Jedenfalls eifert jede Kreisstadt diesem Ansatz hinterher, versucht Geschenkeläden so einzurichten wie die am Prenzlauer Berg, Bars so schummrig und schnodderig aussehen zu lassen wie in Neukölln und orientiert sich in Modefragen an Mitte. Hipsterbashing war mir schon immer zu mühsam und einfältig. Ich habe kein Problem mit ihnen: Ich sehe sie nur gerne an.
Meine letzte Station in Jena ist vermutlich inspiriert durch die akute Berlinsehnsucht: Es ist ein sehr szeniges Burgerrestaurant, stimmige Einrichtung aus Europaletten und alten Obst- und Weinkisten, modern designte Speisekarten mit Vintageelementen, Burger mit selbst gebackenen Brötchen und Avocadocreme. Ich trinke hier lediglich etwas und werde dafür etwas irritiert angesehen, was mich wiederum verwundert, denn immerhin steht neben der Aufschrift „Restaurant“ auch „Bar“ an der Scheibe geschrieben. Menschen anschauen kann ich hier vorzüglich, vor allem die hübschen, die Studenten, diejenigen die sich chic (aber um Gottes willen nicht zu chic!) machen, um einen Burger und Fritten zu essen. Ich halte mein Fähnlein hier in eine Berliner Brise, es bleibt oberflächlich aber stillt meine Sehnsucht nach dieser geliebt, gehassten Hipsterbohème. Macht man es sich nicht recht einfach, fast schon zu leicht, wenn man sagt, diese Übercoolnes wäre typisch für Berlin und nur dort zu finden? Jedenfalls eifert jede Kreisstadt diesem Ansatz hinterher, versucht Geschenkeläden so einzurichten wie die am Prenzlauer Berg, Bars so schummrig und schnodderig aussehen zu lassen wie in Neukölln und orientiert sich in Modefragen an Mitte. Hipsterbashing war mir schon immer zu mühsam und einfältig. Ich habe kein Problem mit ihnen: Ich sehe sie nur gerne an.
–
 Ich lese hier noch gründlich die Zeitung zu ende – inklusive Todesanzeigen und Partnergesuchen – und mache mich anschließend auf den Weg zurück zum Zelt. Allerdings muss ich mich noch ein letztes mal an das Ufer setzen und Paradies zusehen, wie es vor mir her fließt. Schließlich soll Jena selbst den letzten Eindruck von Jena bekommen und nicht ein neumodisches Berliner Abziehbild. In der Bucht neben mir sitzt eine junge Frau ebenfalls auf einem Baum. Sie unterhält sich mit einem Ausländer, er spricht nur sehr gebrochenes Deutsch, genaueres kann ich nicht verstehen. Ich sitze lediglich zwei Minuten an meinem Platz, als sie zügig zur Straße aufbricht. Zehn Sekunden später steht der Ausländer neben mir und unterbricht meine Notizen. Es ist der Junge, der am Abend zuvor immer wieder überschwänglich grüßend durch das Unterholz gesprintet ist. Nun setzt er sich zu mir und wirkt sehr, sehr wirr, seine Augen flackern erst konfus, dann fokussieren sie mich wieder ernst. Einige kleine Wunden hat er heute im Gesicht und an den Armen. Er zeigt auf sie und deutet an, irgendwo hinunter gefallen zu sein, wobei er auf den Jenzig deutet. Meine Wasserflasche interessiert ihn, ich gebe sie ihm und er trinkt sie in einem einzigen Zug beinahe vollständig aus. Wir versuchen uns zu unterhalten, aber ich verstehe ihn nicht. Er sagt er spreche alle Sprachen, Englisch, Französisch, Deutsch, alles – doch weder kann er mich verstehen, noch kann er sich selbst ausdrücken. Ich frage ihn, woher er kommt. Syria? Irak? Afghanistan? Er sei von hier, antwortet er. „Hier! Hier!“ und zeigt auf den Boden vor sich. Und wenn er sich nicht verständigen kann, so weiß er doch eines: Er hat ein Samsung Telefon, während sein Vater ein Apple besitzt – und es regt ihn furchtbar auf. Er zeigt auf meinen Bart und macht die Zeichen einer Schere. Er sei „Barbier“ meint er, er könne das. Ich versuche immer wieder herauszufinden, wie er heißt, woher er kommt, ob er Hilfe braucht. Ich versuche sein Kauderwelsch zu entschlüsseln, doch es bleibt beim Versuch – wir nähern uns nicht an. Er wirkt alles andere als bescheiden, hat eine aggressive Körpersprache wie sie nun mal eigen ist für pubertäre Jungs. Irgendwann, wir sitzen bereits eine halbe Stunde auf diesem Ast und reden unaufhörlich aneinander vorbei, zeigt er auf meine Hand und deutet einen Ring an. „Frau!“ sagt er. „Nein, keine Frau.“ „Schlecht!“ sagt er, „musst Frau haben, Kinder machen!“ Das kann er also sagen und ich werde sauer und wütend auf ihn. Natürlich ist es auch von mir anmaßend zu denken, ich würde ihm helfen können, zu denken, er würde meine Hilfe benötigen. Aber dass ich mir nun meine Ehepflichten von ihm darlegen lassen muss, das wird mir hier und jetzt eindeutig zu viel des Guten. Er sieht die Verärgerung in meinem Blick, auch dies ist klar. Ich überlasse ihm den Rest meines Wassers und verschwinde in Richtung Slow-Camping, noch immer etwas frustriert über dieses Nichtgespräch voller potentieller Konflikte.
Ich lese hier noch gründlich die Zeitung zu ende – inklusive Todesanzeigen und Partnergesuchen – und mache mich anschließend auf den Weg zurück zum Zelt. Allerdings muss ich mich noch ein letztes mal an das Ufer setzen und Paradies zusehen, wie es vor mir her fließt. Schließlich soll Jena selbst den letzten Eindruck von Jena bekommen und nicht ein neumodisches Berliner Abziehbild. In der Bucht neben mir sitzt eine junge Frau ebenfalls auf einem Baum. Sie unterhält sich mit einem Ausländer, er spricht nur sehr gebrochenes Deutsch, genaueres kann ich nicht verstehen. Ich sitze lediglich zwei Minuten an meinem Platz, als sie zügig zur Straße aufbricht. Zehn Sekunden später steht der Ausländer neben mir und unterbricht meine Notizen. Es ist der Junge, der am Abend zuvor immer wieder überschwänglich grüßend durch das Unterholz gesprintet ist. Nun setzt er sich zu mir und wirkt sehr, sehr wirr, seine Augen flackern erst konfus, dann fokussieren sie mich wieder ernst. Einige kleine Wunden hat er heute im Gesicht und an den Armen. Er zeigt auf sie und deutet an, irgendwo hinunter gefallen zu sein, wobei er auf den Jenzig deutet. Meine Wasserflasche interessiert ihn, ich gebe sie ihm und er trinkt sie in einem einzigen Zug beinahe vollständig aus. Wir versuchen uns zu unterhalten, aber ich verstehe ihn nicht. Er sagt er spreche alle Sprachen, Englisch, Französisch, Deutsch, alles – doch weder kann er mich verstehen, noch kann er sich selbst ausdrücken. Ich frage ihn, woher er kommt. Syria? Irak? Afghanistan? Er sei von hier, antwortet er. „Hier! Hier!“ und zeigt auf den Boden vor sich. Und wenn er sich nicht verständigen kann, so weiß er doch eines: Er hat ein Samsung Telefon, während sein Vater ein Apple besitzt – und es regt ihn furchtbar auf. Er zeigt auf meinen Bart und macht die Zeichen einer Schere. Er sei „Barbier“ meint er, er könne das. Ich versuche immer wieder herauszufinden, wie er heißt, woher er kommt, ob er Hilfe braucht. Ich versuche sein Kauderwelsch zu entschlüsseln, doch es bleibt beim Versuch – wir nähern uns nicht an. Er wirkt alles andere als bescheiden, hat eine aggressive Körpersprache wie sie nun mal eigen ist für pubertäre Jungs. Irgendwann, wir sitzen bereits eine halbe Stunde auf diesem Ast und reden unaufhörlich aneinander vorbei, zeigt er auf meine Hand und deutet einen Ring an. „Frau!“ sagt er. „Nein, keine Frau.“ „Schlecht!“ sagt er, „musst Frau haben, Kinder machen!“ Das kann er also sagen und ich werde sauer und wütend auf ihn. Natürlich ist es auch von mir anmaßend zu denken, ich würde ihm helfen können, zu denken, er würde meine Hilfe benötigen. Aber dass ich mir nun meine Ehepflichten von ihm darlegen lassen muss, das wird mir hier und jetzt eindeutig zu viel des Guten. Er sieht die Verärgerung in meinem Blick, auch dies ist klar. Ich überlasse ihm den Rest meines Wassers und verschwinde in Richtung Slow-Camping, noch immer etwas frustriert über dieses Nichtgespräch voller potentieller Konflikte.
Gestern Abend also das nach Schlachtruf klingende Kinderlied über die „Neger“, heute der fremde Junge, der mit den Vorurteilen jongliert. Schaffen wir das? Natürlich schaffen wir das, aber es könnte phasenweise recht holprig und ungemütlich werden.
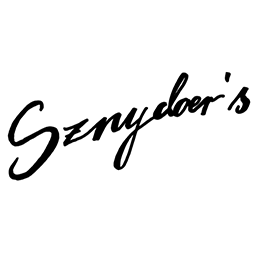



Leave a Reply