BAD SULZA – JENA
–
Am nächsten Morgen erwartet mich ein episches Frühstücksbuffet in einem monumentalen Speisesaal. Ich teile mir diese übertriebenen Ausmaße mit einer einzigen Frau, die am anderen Ende der gigantischen Speisehalle sitzt und auffällig unauffällig Obst in ihrer Damenhandtasche verschwinden lässt. Langsam und verschlafen gesellen sich einige weitere Menschen hinzu, ich bleibe jedoch neben der Bedienung der mit Abstand jüngste im Raum. Dann erscheinen ein Vater und seine Tochter im Teenageralter – was hat die beiden hierher verschlagen? Er scheint der glücklichste Papa der Welt zu sein, selten habe ich jemanden so sehr sein Frühstücksei und die Zeitung genießen sehen. Immer wieder schaut er von der Lektüre auf und lächelt seine Tochter an. Sie hingegen wirkt genervt oder sehr müde oder beides, isst kaum etwas und starrt pausenlos auf das Display ihres Smartphones als würde sie dort nach Fluchtplänen suchen.
Als ich mit dem Frühstück fertig bin und für Tagesproviant gesorgt habe, indem ich mir aus Mangel einer Umhängetasche einen doch recht auffälligen Patronengurt aus Bananen angelegt habe, steht mein Freund auf und schlürft mir in Richtung des Speisesaals entgegen. So können wir uns noch verabschieden und uns danken für die geteilte Zeit des mühevollen Müßiggangs, bevor ich berauscht von Musik auf den Ohren, frischer klarer Luft um die Nase und sich ankündigendem Sonnenschein derart energisch losmarschiere, als müsste ich den Weg wieder gutmachen, den wir in den vergangenen Tagen nicht gegangen sind. Über ein verlängertes Wochenende ist dies nun zwar keine Auszeit meines Trips gewesen, aber ein Drosseln der Herangehensweise auf den kleinsten gemeinsamen Vielfachen sowie eine Minimalgeschwindigkeit. Daraus entstand ein wohliges Wochenend- und Feriengefühl in der Gesellschaft eines meiner Lieblingsmenschen. Doch nun gilt es, mich wieder auf meine Aufgabe zu fokussieren, Strecke gut zu machen, den kgV in eine Laufgeschwindigkeitsprimzahl zu verwandeln. Somit stürmen meine Beine jenseits von Gut und Böse voran und machen einen gemäßigten Schritt, eine ruhige Herangehensweise zu einer Undenkbarkeit. Lauf, Junge, lauf!
Hier nun, am Ende der Reise, wird Wandern zu einem Extremsport. Ich renne förmlich von Bad Sulza bis Eckolstädt. Selten in meinem Leben habe ich mich so kräftig gefühlt, so motiviert, so angepeitscht von dem Wunsch voran zu kommen, Strecke gut zu machen, über den jeweils nächsten Hügel zu blicken. Beine und Schultern sind wie Mühlsteine, der Schweiß rinnt, die Adern pumpen. Ich befinde mich in einem überaus glücklichen Zustand vollkommener Hingabe und Unterordnung an ein Ziel, dessen zweifelhafter Sinn jeden noch so kritischen Gedanken in mir fortweht und nichtig macht. Wenn doch alles im Leben immer so einfach und simpel wäre.
–

Es sind aber auch Bedingungen zum Erblühen: Ein klarer, frischer Frühlingsmorgen in einem noch jugendlichen Jahr, an dem sich dieses Land den letzten winterlichen Schlaf aus den Augen reibt und beschwingt dazu ansetzt die Straßen zu fegen, die Autos zu putzen, für anstehende Feste zu werben oder den Wocheneinkauf zu erledigen. Fortgeweht scheint die bedrückende Lethargie, das Land und die Menschen nehmen eine neue Stimmung scheinbar gerne an, in die Sonne blinzelnd, sich den Schweiß von der Stirn wischend, mit einem Lächeln die Sisyphosaufgaben ausführend und auch nicht mehr so verwundert dreinschauend, wenn sie einen Wanderer in ihrem Dorf sehen. Das Land wirkt offener.
RADIO RANDOM meint es mal wieder gut mit mir und spielt vorzüglich antreibende Lieder für einen kraftvollen Marsch. Florence prickelt ihr „Lover to Lover“, „Hallo Gallo“ von Neu! mäandert mich über die Hügel, der „Train in Vain“ von The Clash macht die Schultern breiter, „Save it for later“ rät mir The English Beat, dann wieder sorgt „Andrea Doria“ für ein Grinsen auf meinen Lippen und Mitgröhlstimmung zwischen den Feldern. Unglaublich glücklich bin ich; über die Sonne, mein Tempo, die Musik – wieder der Herr über meine Gangart sein zu können. So geht es und so gehe ich knapp zwei Stunden, durch Wiesen voller Windkrafträder auf einem stets geraden Feldweg.
In Eckolstädt dann frage ich eine sehr alte Frau und ihren sehr großen Sohn – er hat Hände wie Tennisrackets – nach dem Weg, während ihr Steffordshire an mir schnüffelnd irgendeinen Erkenntnisgewinn sucht. Sie erklären mir die Route zwar verständlich, doch auf dem beschriebenen Weg verheddere ich mich dann in einem falschen Ausblick und gehe nach links, statt weiter geradeaus. Ich lande in einem wunderschönen lichtdurchfluteten Forst. Meine Schwester ruft mich an und sie wird in der nächsten Stunde Ohrenzeuge, wie ich mich das erste mal so richtig und vollkommen verlaufe. Irgendwann bemerke ich durch den Sonnenstand, dass ich in eine völlig falsche Himmelsrichtung unterwegs bin, dazu noch bergauf, was eigentlich nicht sein dürfte. Ich muss das Telefonat schließlich unterbrechen, denn als ich den Forst verlasse, sehe ich eine Gruppe Männer vor der Silhouette eines kleinen Dorfes neben frisch zersägtem Holz sitzen. Es ist kurz vor elf Uhr und sie alle trinken ein Bier in der Sonne, an diesem Samstag im Mai. Eine junge Frau steht rauchend neben ihnen und schaukelt monoton einen Kinderwagen. Ich höre sie etwas in Richtung der Männer tuscheln, als ich mich der Gruppe nähere.
„Entschuldigung, welcher Ort ist das hier?“ frage ich ins Blaue und die Gruppe hinein. „Eckolstädt“ wird mir entgegnet und ich frage, ob sie das Buch „Der Weg war umsonst“ kennen. Die junge Frau lacht und fragt, ob ich es schon öfters gelesen habe, sie hat mich eine Stunde zuvor durch den Ort streifen sehen. Schnell finden wir gemeinsam meinen Abzweigungsfehler heraus und dann plaudern wir noch einige Minuten über das Werk des Tages, meine Wanderung, ihr gehacktes Holz, das Vergnügen an der Mühe und der Qual. Sie bieten mir ein Bier an und gerne würde ich annehmen und bleiben, aber dann werde ich mein Tagesziel erst zu spät erreichen. Sie wünschen mir alles Gute für den Rest des Weges, ich ihnen viel Spaß beim samstäglichen Schaffen und dann drehe ich meine zweite Runde durch Eckolstädt. Mir begegnen einige Leute, die ich eine Stunde zuvor bereits getroffen habe. Sie schauen mich sehr verwundert an und ich bitte sie, mit einem breiten Grinsen auf den Lippen: „Nicht lachen, ja!“ Und wir alle lachen natürlich darüber, bevor ich die richtige Abbiegung finde und weiter bis nach Dornburg marschiere.
In dieser ansonsten menschenleeren Stadt finde ich schnell einen zentral gelegenen Biergarten, der einen herrlichen Flammkuchen serviert und dessen Kellner mich nach dem Verzehr eine halbe Stunde auf das Bezahlen warten lässt. Während dieser Wartezeit lerne ich eine Familie kennen, der ich schon einmal meinen Tisch anbiete. Sie mustern mich neugierig und stellen schließlich einige Fragen. Der Stock, die kurzen Hosen, der große Rucksack – das alles wirkt noch immer verwunderlich. Als ich ihnen von den Eckdaten meiner Reise berichte, werden sie regelrecht euphorisch, haken neugierig weiter nach und während ich am überlegen bin, noch etwas mit ihnen zu trinken, kommt tatsächlich der Ober mit meiner Rechnung und beschleunigt somit meinen Abschied.
–
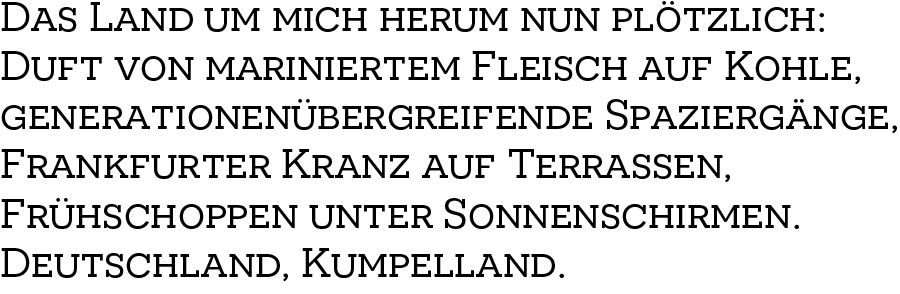
Jena sehe ich viel zu früh am Horizont und das Umland der Stadt überrascht mich direkt positiv. Es ist Samstag und der Tag sieht auch nach einem solchen aus: Dutzende Paare, Grüppchen, Familien radeln und streifen durch das Umland, genießen den Flusslauf, die Sonne, die Vorstadt und Kleingärten. Wuseliges Treiben an der frischen Luft, es wird Bier am Fluss getrunken und Joints in kleinen Gruppen geraucht, grüßende und grinsende Menschen freuen sich offensichtlich endlich wieder draußen aktiv sein zu können. Jenas Umland versöhnt mich mit den Menschen, die ich in den vergangenen Wochen so selten draußen antreffen konnte, die mich so unverschämt lange alleine gelassen haben.
Etwas außerhalb Jenas, kurz vor und kurz hinter dem Erlkönig, habe ich zwei Schlender- und Zaungespräche. Das erste ergibt sich im vorübergehend geteilten Schritttempo mit einer eleganten älteren Dame in Kostüm und Sonnenhut. Zusammen mit Ihrer Tochter schiebt sie das blutjunge Enkelkind durch dessen ersten Frühling. Sie ist ganz aus dem Häuschen über meine Reise. Herrlich stürmisch nimmt sie mich in den Arm, hakt sich für einige Meter bei mir ein. Auch sie kommt in ihrer Impulsivität rasch auf die üblichen Schlagwörter zu sprechen. Angst, Gefahr, Kälte. Aber sie schwärmt auch von der Freiheit, der Zeit in der Natur, der Erfahrung für mich persönlich. Ich sage ihr, dass ich mir Sorgen um Deutschland mache. Wenn man jemanden wie mich trifft – zwinkert sie mir zu, bestünde kein Anlass zur Sorge um dieses Land. Ob sie das gleiche denken würde, wenn ich beispielsweise ein Iraker wäre. „Dann würden wir uns vielleicht nicht so angeregt unterhalten können, junger Mann, aber ansonsten fände ich das genauso reizend!“ Werde ich gerade angeflirtet? Wie dem auch sei: Ihre Antwort ist ein Traum und sie ein hinreißender Mensch, zuversichtlich, leidenschaftlich, schlagfertig. Ich lege gleich meine Zurückhaltung ab und flirte zurück. Ihrer Tochter jedoch ist der Überschwung ein wenig peinlich und deshalb finde ich die Tochter wiederum ein wenig peinlich, denn mit ihrer Mutter könnte ich jetzt gerne noch etwas mitgehen. Wir verbleiben mit den besten gegenseitigen Wünschen und sie winkt mir innig hinterher. Kurz darauf treffe ich auf ein Paar vor ihrer Datscha, sie haben beide beeindruckend üppige Bäuche. Sie strahlen um die Wette und ich steige in das Spiel mit ein. „Frühjahrsputz?“ erkundige ich mich. Sie sind dabei allerlei Gerätschaften aus dem Auto in den Garten zu tragen. „Jawoll!“ antwortet er und nimmt eine kurze Pause gerne schnaubend an, den Schweiß mit einem Papiertaschentuch von der Stirn wischend. Fast meine komplette Route kennt er, sie sind überall gewesen. „Aber noch kein mal im Westen!“ steigt sie in die Unterhaltung mit ein. Sächsische Schweiz: Da muss man gewesen sein! Ostsee: Viel schöner als die Nordsee! Seenplatte: Alles was man braucht! Leipzig: Weltstadt! Und wieso noch nie im Westen vorbei geschaut? Hier hat man alles was man braucht! Und warum Jena? Ein Traum! „Das Paradies – also, echt!“ So kumpeln wir uns gegenseitig von oben bis unten zu, die Ellenbogen auf Zaun und Stock gestützt. Kleingartenvereinsstimmung. Frohes Schaffen noch! Jawoll, frohen Marsch noch! So schlendere ich durch die Gartensiedlung weiter in Richtung Campingplatz. Das Land um mich herum nun plötzlich: Duft von mariniertem Fleisch auf Kohle, generationenübergreifende Spaziergänge, Frankfurter Kranz auf Terrassen, Frühschoppen unter Sonnenschirmen. Deutschland, Kumpelland.
Mit dieser silbergestreiften Zuversicht erreiche ich den Jenaer Campingplatz. Eine famose Unterkunft! Als Leitgedanken haben sie sich hier „Slow-Camping“ ausgedacht. Diese Maxime wird authentisch vor- und ausgelebt, sowohl durch die Ausstrahlung der Betreiber, als auch in der Atmosphäre ihres Platzes. Dessen Wappentier stellt eine Schnecke dar, deren Haus in Form eines Campingwagens gestaltet wurde. Was ich hier bereits in den ersten fünf Minuten meines Aufenthalts an Eindrücken wahrnehmen kann, widerlegt ein Bündel oft bestätigter Klischees, das man über biedere und kleinbürgerliche Campingplatzlebenswelten mit sich tragen mag. Die Rezeption befindet sich in einem antiken Bahnwagon. Meine ersten neuen Nachbarn stellen barfuß und beinahe blank eine angenehm schlüpfrige Hippie-Attitüde aus. Junge Paare, Alternative, Schweizer, ein Unimog, viel Haut, offenes Getatsche. An einem solchen Ort werden Kinder gezeugt. Nichts zu spüren von der „Tach!“ – Mentalität, mit der auf anderen Campingplätzen miese Mienenspiele in frottierten Tschibo-Bademänteln ihre Klopapierrollen und Kulturbeutel durch die Gegend tragen. Kein Gast würde hier auf den Gedanken kommen, irgendeine Nationalfahne zu hissen.
Der Campingplatz ist ein Familienunternehmen, Bruder und Schwester leiten den Platz und beide sind sie außergewöhnliche Gastgeber. Äußerst interessiert fragt er beim Aufnehmen der Daten nach meiner Route, nach Motiven die mich bewegen, hakt nach warum ich Jena als einen Stop gewählt habe, spricht von seinen eigenen Rucksackreisen ohne aufdringlich oder penetrant zu werden. Er gibt mir zahlreiche Tipps für die Wanderungen in und um Jena herum, immerhin liegt der Campingplatz am Fuße des beeindruckenden Jenzigs.
Kinder rennen und tollen um uns herum, direkt neben dem von der Schwester betriebenen Kiosk befindet sich ein Fußballplatz, auf dem eine lautstark und energisch angefeuerte Partie ausgetragen wird. Einige Leute auf dem Campingplatz haben sich Klappstühle an den Zaun gestellt und beobachten das Spiel. Jemand spricht von einer Made. „Hier ist eine Made! Gib’ sie dem Vogel!“ Die kindliche Stimme bricht vor Aufregung. Ein kleines Mädchen kommt, nimmt die Made und verschwindet hinter den Rezeptionsbahnwagon. Ich folge ihr und sehe dort einen sehr alten Mann, der einen sehr kleinen Vogel in seinen sehr zitterigen Händen hält und diesen innigst mit seiner Nase liebkost und wärmt. Er spricht der kleinen Amsel, die aus dem Nest gefallen ist und nun hier seit zwei Tagen aufgepeppelt wird, Mut und Durchhaltevermögen zu, er flüstert auf sie ein und streichelt sie mit Daumen und Nase. Es ist hinreißend. Schnell baue ich das Zelt auf, denn ich möchte mehr sehen von dieser Stadt und da es erst früher Nachmittag ist, bleibt mir noch viel vom Samstag um zu entscheiden, wie lange ich hier bleiben möchte.
–
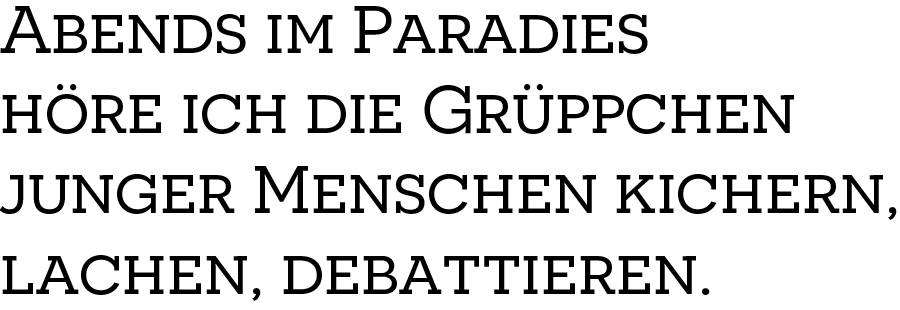 Einen Tag nach der Gaststätte „Himmelreich“ liegt nun das Paradies vor mir, Jena Paradies also, der Stadtteil von dem die Gärtner kurz zuvor sprachen und der sich als grüne Auefläche mit idyllischen Liegewiesen und lichtdurchflutetem Unterholz wirklich und tatsächlich paradiesisch an der Saale entlang schlängelt. Wiesen, Grillrunden, Frisbee – wunderschöne Menschen, Studentenvolk, entspannte Blicke, funkelndes Wasser. Deutschland ist hier ein sehr angenehmer Zeitgenosse, mit dem ich mich in der Sonne räkeln und eine erholsamen, unbeschwerten Nachmittag genießen kann, wenn ich dies möchte. Doch die Wander- und Erkundungslust treibt mich weiter voran durch die Straßen und Gassen der Innenstadt. Während der goldenen Stunde sitze ich schließlich in einer Hollywoodschaukel einige Meter neben Schillers Gartenhaus und beobachte die jungen und hübschen Menschen, die diesen loungigen Biergarten zu einer café-del-marigen Bohémelokalität werden lassen. Tischtennis und Schiller ersetzen Meer und Sand, ein unaufgeregter und in jeder Hinsicht beliebiger After-Work-Jazz-Klangteppich breitet sich über den Gesprächen und Sitzguppen aus. Das sehr laute „Plopp!“ des Bügelverschlusses meines Bieres knallt in die homogene Klangatmosphäre wie ein Böller an Neuköllner Juliabenden. Der Wirt ruft ebenso laut und durch den Biergarten schmetternd zurück „Schmecken lassen!“ was mir sofort sympathisch ist. Der junge Mann hat auch keine Angst vor Stimmungsbrüchen. Wehleidig werde ich nun langsam aber sicher darüber, dass dies alles hier für mich bald vorbei sein wird, nun da es beginnt mir so richtig Spaß zu machen, während die Menschen anders gefärbt durch Wetter und Jahreszeit in ihren Lebenswelten spazieren und mein Körper die täglichen Strapazen beinahe beschwerdefrei hinnimmt.
Einen Tag nach der Gaststätte „Himmelreich“ liegt nun das Paradies vor mir, Jena Paradies also, der Stadtteil von dem die Gärtner kurz zuvor sprachen und der sich als grüne Auefläche mit idyllischen Liegewiesen und lichtdurchflutetem Unterholz wirklich und tatsächlich paradiesisch an der Saale entlang schlängelt. Wiesen, Grillrunden, Frisbee – wunderschöne Menschen, Studentenvolk, entspannte Blicke, funkelndes Wasser. Deutschland ist hier ein sehr angenehmer Zeitgenosse, mit dem ich mich in der Sonne räkeln und eine erholsamen, unbeschwerten Nachmittag genießen kann, wenn ich dies möchte. Doch die Wander- und Erkundungslust treibt mich weiter voran durch die Straßen und Gassen der Innenstadt. Während der goldenen Stunde sitze ich schließlich in einer Hollywoodschaukel einige Meter neben Schillers Gartenhaus und beobachte die jungen und hübschen Menschen, die diesen loungigen Biergarten zu einer café-del-marigen Bohémelokalität werden lassen. Tischtennis und Schiller ersetzen Meer und Sand, ein unaufgeregter und in jeder Hinsicht beliebiger After-Work-Jazz-Klangteppich breitet sich über den Gesprächen und Sitzguppen aus. Das sehr laute „Plopp!“ des Bügelverschlusses meines Bieres knallt in die homogene Klangatmosphäre wie ein Böller an Neuköllner Juliabenden. Der Wirt ruft ebenso laut und durch den Biergarten schmetternd zurück „Schmecken lassen!“ was mir sofort sympathisch ist. Der junge Mann hat auch keine Angst vor Stimmungsbrüchen. Wehleidig werde ich nun langsam aber sicher darüber, dass dies alles hier für mich bald vorbei sein wird, nun da es beginnt mir so richtig Spaß zu machen, während die Menschen anders gefärbt durch Wetter und Jahreszeit in ihren Lebenswelten spazieren und mein Körper die täglichen Strapazen beinahe beschwerdefrei hinnimmt.
Ich lasse die Schaukel und den szenigen Biergarten hinter mir und schlage noch ein paar Haken durch die Innenstadt. Sekttrinker picheln ihren eisgekühlten Schaumwein an einem Brunnen sitzend, Resterunden des Herrentagswochenendes stoßen in den Wirtshäusern an, ein Junggesellinnenabschied mit Bauchladen voller Schnaps und Kondomen sirent sich durch die feierabendliche Fußgängerzone. Das Leben blüht auf an diesem Abend und es gefällt mir, dabei zuzusehen. Natürlich esse ich wieder gutbürgerlich und erwische eine zu Späßen und Grinsereien aufgelegte Bedienung. Ihre Chefin jedoch mahnt sie mit Blicken und kurzen zackigen Gesten zu so etwas wie mehr Eile und Fleiß, womit sich unser Gspusi leider erledigt hat. Die Chefin hingegen, das wird hier und jetzt klar, ist ziemlich angetrunken zwischen den Tischen unterwegs. Heute wäre ihr freier Tag gewesen erklärt sie der bestens aufgelegten Herrengruppe an meinem Nachbartisch. Zum Frustrationsausgleich trinkt sie heute deshalb bereits seit dem Mittag mit einer Kollegin. Na, danke vielmals! Dafür hättest Du mir auch gerne noch zwei, drei lustbetonte Blicke meiner wundervollen Bedienung lassen können.
Nach dem Essen finde ich zwei recht hippe Restaurants, die als Bar dienen könnten, mir für heute allerdings zu viel des Guten und Geselligen wären. Ich beschließe auch den nächsten Tag hier zu verbringen, diese Stadt hat etwas Vielversprechendes.
Abends im Paradies höre ich die Grüppchen junger Menschen kichern, lachen, debattieren. Alles wirkt hier irgendwie kerngesund und richtig wie es vorgelebt und zelebriert wird. Unmittelbar vor mir taucht immer wieder ein Otter auf und verschwindet panisch und ruckartig im dunklen Wasser sobald ich mich bewege. Wie um das Klischee des freundlichen Flüchtlings zu bestätigen, läuft ein Junge ständig durch das Unterholz und grüßt jeden im Vorübergehen überschwänglich mit „Hallo Hallo, wunderbar!“ oder „Moin, ja, ja, ganz genau!“ Immer wieder läuft er auch an mir vorbei und schmettert mir seine Floskeln entgegen, scheinbar ohne eine Antwort zu erwarten.
Weil dies hier alles zum Entspannen und Erholen einlädt, weil die Jenaer Atmosphäre so offensichtlich unbeschwert daherkommt, weil das Stadtbild geprägt scheint von jungen Hedonisten, Studenten, Lebensbejaern – deshalb wundere ich mich über den NSU, der seine Wurzeln hier hat, in Jena Winzerla. Die beiden Bilder passen schwerlich über- und zueinander. Hollywoodschaukel, Schiller, Universitätsvolk – und eine rechte Terrorzelle, die beiden Uwes, die Beate, der Thüringer Heimatschutz. Und während ich mich auf dem Heimweg diesen Gedanken hingebe bemerke ich, dass ich mich etwas verlaufen habe. Ich wollte einen anderen Weg als am Nachmittag gehen und wenn ich stetig an der Saale entlang laufen würde, so hätte ich – dem maßstabsungetreuen Plan des Campingplatzes zum Trotz – diesen schließlich dennoch erreichen müssen. Irgendwann sieht es um mich herum allerdings etwas zu sehr nach Industriegebiet aus und nicht nach dem Schwimmbad, das hier plangemäß eigentlich zu finden sein sollte. Ich nehme einige Diagonalen in die vermutete Richtung und höre Gesänge in der Ferne, an denen ich mich orientiere. Irgendwann bin ich sehr nahe an dem Gesang, der aus der Dunkelheit und um zwei Ecken herum zu mir vordringt. Er ist ansteigend und wird aggressiver, ich verstehe nun den Text, sie singen das Lied von den zehn nackten Negern. Sie singen erst, dann grölen sie, dann schreien sie. Und wie das Wort Neger durch die Dunkelheit hallt, bekomme ich es tatsächlich mit der Angst zu tun und umklammere meinen Stock, der mir heute in der Stadt so sinnfrei vorgekommen ist. Trifft sich also hier nachts der Thüringer Heimatschutz und lebt seine Version des ostdeutschen Ku-Klux-Klans aus? Ich drehe einmal um, in der Hoffnung einen alternativen Weg zu finden und erreiche wieder die vorgelagerte Hauptstraße ohne Bürgersteig. Zwecklos, ich muss an den Schreihälsen vorbei. Langsam und vorsichtig schleiche ich durch die Dunkelheit, bis ich erkenne von wo sich der Gesang ausbreitet. Er kommt von der erleuchteten Ecke eines Sportplatzes und nun kann ich es genau sehen: Ich stehe neben dem Fußballplatz, auf dem heute Mittag dieses leidenschaftliche Spiel ausgetragen wurde. Direkt neben meinem Zeltplatz wird heute Nacht also eine kleine Meisterfeier zelebriert. Es muss die pure Freude sein, Flaschen klimpern, monumentales Gerülpse hallt über Fußball- und Campingplatz, und vereint im Lied über die zehn nackten Neger schreit diese Mannschaft ihre Siegesstimmung hinaus in die Jenaer Nacht. Trotz der paradiesischen Vorzeichen des bisherigen Tages wirkt diese Abschlusserfahrung nach wie ein bitterer Leberhaken.
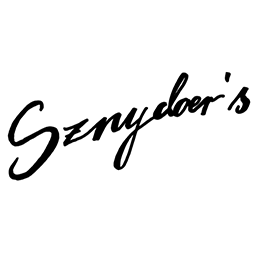



Leave a Reply