LEIPZIG
–

Als ich den Hausflur betrete und sich die Wohnungstür öffnet, steht er lachend und seine Hände über dem Kopf schlagend vor mir. Wiedersehensstimmung.
In Leipzig bin ich von einem alten Freund eingeladen, den ich von einigen sehr sporadischen und der Zufälligkeit geschuldeten Kurztreffen abgesehen, seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe. Immer wieder vorgenommen, niemals wirklich umgesetzt. Viel ist passiert in dieser Zeit, und so sitze ich am Nachmittag auf dem gemütlichen Sofa einer grandiosen Altbauwohnungsbelletage und schaue mit dem einen Auge auf ein großformatiges Bild der Leipziger Schule und mit dem anderen auf ein zwei Wochen junges, wundervolles Baby. So schweigsam und beruhigend meine vergangenen Wochen waren, so aufgedreht und redselig sind meine Stunden hier, denn die junge Familie ist neugierig und interessiert und genauso ergeht es mir mit ihnen. Wir spielen ein mehrstündiges Frage-Antwort-Ping-Pong, grillen auf dem Balkon, stoßen gemeinsam auf Familie, Pläne, das Leben an, diskutieren über das Land, die Stadt, die Zukunft und unsere Erwartungen. Ich bade, nein, ich suhle mich in einem warmen See der Gastfreundschaft. Es ist eine kleine Ode an die Freundschaft und ich kann kaum fassen, was hier passiert, obwohl ja lediglich dreieinhalb Leute eine angenehme Zeit auf einem Balkon verbringen. Sind dies die kleinen Dinge, von denen sprichwörtlich die Rede ist? Nein, es ist etwas Großes. „Zu Hause“ – das sind Orte, an denen man gute Menschen um sich herum hat und nicht darüber nachdenken muss, etwas besonders geistreiches sagen zu müssen. Diese guten Menschen – Freunde – sind ein Inbegriff von Lebensqualität. Heulen könnte ich vor Freude!
Am Ende wird sehr früh zu Bett gegangen, nach all den Nächten auf meiner Iso-Matte oder in Pensionsbetten schlafe ich hier in einem Wasserbett wie ein grinsender Stein.
Wir frühstücken noch gemeinsam, grandios gedeckt, in aller Ruhe und Ausgelassenheit. Dann überlasse ich sie den nahenden nächsten Gästen.
Es ist nicht so, dass ich die guten Menschen in meinem Leben in den vorangegangenen Wochen ständig schmerzlich vermisst hätte. Ich fühlte mich prächtig, solange die Welt nur an mir vorüberzog, als einsam hätte ich mich nicht bezeichnet. Doch diese hier in Leipzig erlebte Wärme, die mich durch geteilte Neugier und Begeisterung in ein wohliges Gefühl von Heimat und Zuhause gleiten ließ – gekennzeichnet und charakterisiert durch Konversation fernab jeglicher Handlungssysteme – hinterlässt eine schmerzliche Lücke, als ich wieder durch die Stadt laufe: Alleine aber angesteckt und bunt bepinselt mit Lebensfreude, Interesse, Fürsorge. Wohin mit mir? Die Frage hat sich zuvor von selbst beantwortet, nun hämmert sie ohne den Impuls einer griffigen Antwort gegen meinen Kopf, thront auf einem Gedankenhäuflein voller Zweifel und melancholischer Verklärung. Wandern? Ich würde nun viel lieber ein kleines Grillfest mit guten Freunden feiern. Zwanzig Stunden Willkommenskultur und plötzlich bin ich ein anderer Mensch.
Willkommenskultur – für mich ist dies ein warmes Wort, trotz seiner typisch deutschen Härte mit den strengen Ks und Ts und den düsteren Us. Bei der Willkommenskultur handelt es sich wohl um die allgemeine Atmosphäre den und dem Fremden, den Gästen, den Besuchern gegenüber. Früher nannte man es wohl schlichtweg Gastfreundschaft.
Vielleicht aber findet die Willkommenskultur ihren Ausdruck gerade in der Tat eines einzelnen; dem Empfangen und Begrüßen an einem Bahnhof, der Fürsorge durch ein zur Verfügung stellen von Unterkunft und Nahrung für bedürftige Vertriebene oder Geflohene. Einem Austausch an Wissen und Kultur, eine unausgesprochene Einigung darauf, dass der Gast unter dem Dach und an der Hand des Gastgebers nichts fürchten muss, mehr noch: Dass sich um ihn gekümmert wird. Ein gelebtes „Schön, dass du hier bist. Angenehm, dich kennen zu lernen. Kann ich dir behilflich sein?“ Pragmatischer Realoansatz: Eine helfende Hand des Humanismus und der Nächstenliebe, sowie eine weisende Hand, die zu den Lehren des hiesigen Kulturkreises führt; der Gesellschaft, den Gesetzen, Rechten und Pflichten. Danach klingt Willkommenskultur für mich.
Wenn ich aber nun kein hilfsbedürftiger Flüchtling bin, sondern lediglich ein Gast in einem fremden Ort, wodurch definiert sich dann die Willkommenskultur?
Dresden und Leipzig haben in etwa gleich viele Einwohner, doch die Atmosphäre in beiden Städten könnte gegensätzlicher kaum sein. Es weht tatsächlich dieser Egalikeits-Geist Berlins durch diese Bücherstadt, kaum jemand starrt mich an in meiner Montur. Leipzig sagt mir, dass ich mich hier verhalten kann, wie ich möchte ohne jemanden damit zu belästigen. Junge Menschen und junge Denke wohin mein Auge blickt. Natürlich auch zu sehen: Touristen, Einkaufszentren, Fußgängerzone, Selfiesticks und Fastfood in sämtliche Blickrichtungen. Doch ist hier in dieser Stadt alles durchzogen mit Bücher tragenden jungen Menschen, die das Zentrum in einem ständigen Fluss des Unterwegsseins halten. Das ist ebenso gut für die Stadt, wie für mein reizorientiertes Befinden. Ich fühle mich eingeladen und aufgefordert, an diesem Fluss der samstäglich dahingelebten Leichtigkeit teilzunehmen und so entscheide ich mich für das einzig Richtige, nämlich noch eine weitere Nacht in Leipzig zu bleiben.
–
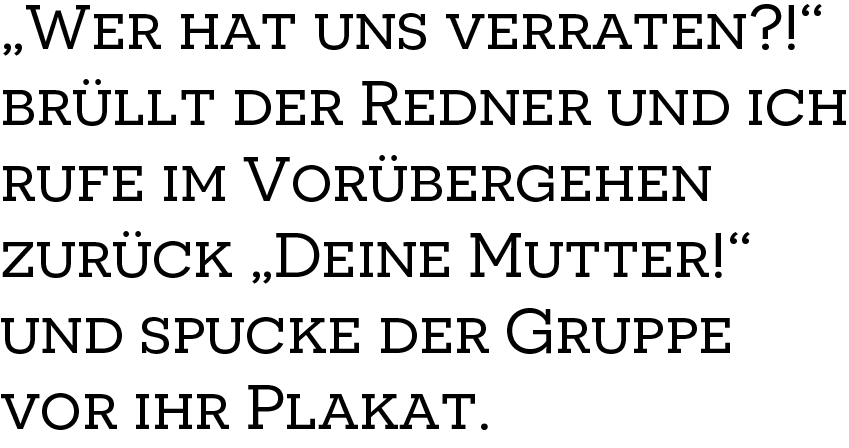 Ich lasse mich quer durch die Stadt treiben, linke Haken, rechte Diagonalen, Obstschalen, Szeneviertel, Einkaufstaschen, und baue mein Zelt an einem See in der Großwohnsiedlung Grünau auf. Hier versprüht die Stadt schon keinen so reizenden Charme mehr, doch steht ihr dieser Kontrast natürlich blendend. Nur schön und vital und gesund, das wäre doch langweilig. In Grünau stößt jeder jemals und aus welchen Kriterien auch immer zurechtgewinkelte Kubikzentimeter Wohndesign jedem in irgendeiner Art ästhetisch orientierten Menschen mit Anlauf vor den Kopf. Wer hier lebt muss aggressiv oder depressiv oder beides werden, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich laufe in zwei Tagen gute fünfzig Kilometer durch diese Stadt und lediglich in Grünau finde ich die hässlichen faschistoiden Botschaften wie sie in Cottbus, Riesa, Radebeul und andernorts teils über die komplette Stadt geschmiert waren. Es ist der Leipziger Stadtteil mit einer anderen Willkommenskultur, die der spröden rechten Winkel und der Zäune um Freizeitanlagen und Zelte. Alarmanlagen, Steffordshire-Terrier, Jungscliquen an Tankstellen, ein wild um sich schlagender und schreiender Sonnenverbrannter auf einem Supermarktparkplatz, dessen mentaler Stuhl vor längerer Zeit aus der ansonsten womöglich geraden Reihe gezogen wurde.
Ich lasse mich quer durch die Stadt treiben, linke Haken, rechte Diagonalen, Obstschalen, Szeneviertel, Einkaufstaschen, und baue mein Zelt an einem See in der Großwohnsiedlung Grünau auf. Hier versprüht die Stadt schon keinen so reizenden Charme mehr, doch steht ihr dieser Kontrast natürlich blendend. Nur schön und vital und gesund, das wäre doch langweilig. In Grünau stößt jeder jemals und aus welchen Kriterien auch immer zurechtgewinkelte Kubikzentimeter Wohndesign jedem in irgendeiner Art ästhetisch orientierten Menschen mit Anlauf vor den Kopf. Wer hier lebt muss aggressiv oder depressiv oder beides werden, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich laufe in zwei Tagen gute fünfzig Kilometer durch diese Stadt und lediglich in Grünau finde ich die hässlichen faschistoiden Botschaften wie sie in Cottbus, Riesa, Radebeul und andernorts teils über die komplette Stadt geschmiert waren. Es ist der Leipziger Stadtteil mit einer anderen Willkommenskultur, die der spröden rechten Winkel und der Zäune um Freizeitanlagen und Zelte. Alarmanlagen, Steffordshire-Terrier, Jungscliquen an Tankstellen, ein wild um sich schlagender und schreiender Sonnenverbrannter auf einem Supermarktparkplatz, dessen mentaler Stuhl vor längerer Zeit aus der ansonsten womöglich geraden Reihe gezogen wurde.
Auf der anderen Seite: Lindenau, Südvorderstadt, Connewitz, sogar das vielerorts so menschenfeindliche Zentrum – es wirkt hier alles ausgesprochen tolerant. Dazu die Kultur der Stadt an sich, die lange Messegeschichte, historisches Zentrum des Buchdrucks und -handels, die traditionsreichen Universitäten, dazu Bach und Mendelssohn-Bartholdy, Auerbachs Keller und natürlich die prägende Rolle der Stadt im Herbst 1989. „Leipziger Freiheit“ damit bewirbt die Stadt auch sich selbst und verweist damit auf ihre Geschichte. Ich spüre wahrscheinlich nicht diese Geschichte – denn wie soll das bitte funktionieren? – wenn ich mich in dieser Stadt bewege, aber sicher wohl die Auswirkungen dieser Geschichte auf das Selbstverständnis Leipzigs, auf den Vibe in seinen Straßen. Ich kann sagen, dass ich mich hier sofort sehr wohl fühle. Weitere Charakteristika für diesen Zustand: Diversität und Ambivalenz. Es ist wie mit Grünau: Nur schön und gesund geht eben nicht.
–
Und so kommt es, dass ich auch hier zufällig in die  Demonstration von einem guten Dutzend besorgter Bürger hineinlaufe und ihnen natürlich auch ihren Teil Leipziger Freiheit von Herzen gönne – sicherlich dürft ihr hier unter Polizeischutz demonstrieren und eure Meinung sagen. Dürft fordern, dass Grüne, Linke und SPD verboten werden sollen, weil sie Linksextremismus unterstützen, „SOZIALFASCHISTEN FÜTTERN DIE LINKSFASCHISTEN“ steht dort beispielsweise auf ihren leider mal wieder typisch deutsch gestalteten Plakaten. Doch die Freiheit, die abweichende Meinung zu diesem kruden Spuk zu äußern, möchte ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen: „Wer hat uns verraten?!“ brüllt der Redner und ich rufe im Vorübergehen zurück „Deine Mutter!“ und spucke der Gruppe vor ihr Plakat. Einer der Demonstranten ruft mir kläffend hinterher, läuft einige Schritte in meine Richtung und droht mir durch seine Körpersprache und Gesten. Ich klopfe zweimal mit meinem Stock auf den Boden und signalisiere ihm somit, zu mir zu kommen, bereit zum Äußersten, nämlich zur Gewalt und damit zum Verlassen meiner teilnehmenden Beobachtung. Wenn es der Wahrheitsfindung dienen mag, hat HaJo Friedrichs hier nun ausgedient, die Zeit der Argumente wäre für mich vorbei, Rückgrat, Haltung, Chuzpe, Schneid, Hybris – danach dürstet es mir, wenn ich dieses Häuflein versprengter Narren sehe. Es ist das Gegenteil des Egaligkeitsmodus, es ist mir eine prickelnd-schäumende Herzensangelegenheit. Und wenn ich von den Polizisten abgeführt werden muss weil ich die Peinlichkeit begehe, mich am helllichten Samstagmittag in der Leipziger Fußgängerzone zu prügeln – sei’s drum. Es ist ein kurzer Moment, in dem die Solidarisierung in eine Radikalisierung umschwenkt. Ich spüre Adrenalin, meine Muskeln spannen sich an. Ich fühle Bedarf nach Aktionismus, habe keine Angst sondern möchte insgeheim tatsächlich, dass er zu mir kommt und mir noch mehr Grund gibt, als einfach nur er selbst zu sein – was mir hier und jetzt natürlich schon ausreichen würde. Er kommt nicht sondern dreht sich wieder um, beeindruckt von meinem Blick oder dem Stock oder vielleicht am Ende diesen Ticken schlauer, als ich es ihm zugetraut hätte und ich selbst es hier und jetzt ganz sicher gewesen bin. Nach dieser albernen Entgleisung benötige ich wohl etwas Ruhe und Ausgleich.
Demonstration von einem guten Dutzend besorgter Bürger hineinlaufe und ihnen natürlich auch ihren Teil Leipziger Freiheit von Herzen gönne – sicherlich dürft ihr hier unter Polizeischutz demonstrieren und eure Meinung sagen. Dürft fordern, dass Grüne, Linke und SPD verboten werden sollen, weil sie Linksextremismus unterstützen, „SOZIALFASCHISTEN FÜTTERN DIE LINKSFASCHISTEN“ steht dort beispielsweise auf ihren leider mal wieder typisch deutsch gestalteten Plakaten. Doch die Freiheit, die abweichende Meinung zu diesem kruden Spuk zu äußern, möchte ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen: „Wer hat uns verraten?!“ brüllt der Redner und ich rufe im Vorübergehen zurück „Deine Mutter!“ und spucke der Gruppe vor ihr Plakat. Einer der Demonstranten ruft mir kläffend hinterher, läuft einige Schritte in meine Richtung und droht mir durch seine Körpersprache und Gesten. Ich klopfe zweimal mit meinem Stock auf den Boden und signalisiere ihm somit, zu mir zu kommen, bereit zum Äußersten, nämlich zur Gewalt und damit zum Verlassen meiner teilnehmenden Beobachtung. Wenn es der Wahrheitsfindung dienen mag, hat HaJo Friedrichs hier nun ausgedient, die Zeit der Argumente wäre für mich vorbei, Rückgrat, Haltung, Chuzpe, Schneid, Hybris – danach dürstet es mir, wenn ich dieses Häuflein versprengter Narren sehe. Es ist das Gegenteil des Egaligkeitsmodus, es ist mir eine prickelnd-schäumende Herzensangelegenheit. Und wenn ich von den Polizisten abgeführt werden muss weil ich die Peinlichkeit begehe, mich am helllichten Samstagmittag in der Leipziger Fußgängerzone zu prügeln – sei’s drum. Es ist ein kurzer Moment, in dem die Solidarisierung in eine Radikalisierung umschwenkt. Ich spüre Adrenalin, meine Muskeln spannen sich an. Ich fühle Bedarf nach Aktionismus, habe keine Angst sondern möchte insgeheim tatsächlich, dass er zu mir kommt und mir noch mehr Grund gibt, als einfach nur er selbst zu sein – was mir hier und jetzt natürlich schon ausreichen würde. Er kommt nicht sondern dreht sich wieder um, beeindruckt von meinem Blick oder dem Stock oder vielleicht am Ende diesen Ticken schlauer, als ich es ihm zugetraut hätte und ich selbst es hier und jetzt ganz sicher gewesen bin. Nach dieser albernen Entgleisung benötige ich wohl etwas Ruhe und Ausgleich.
Am frühen Nachmittag liege ich also im Clara-Zetkin Park und bemerke erneut, wie sehr ich Großstädte liebe: Hunderte kleine Grüppchen, hunderte Kleinkinder, hunderte Hunde, Studenten, Pensionäre, Normalos, Schwule, Genießer, Lerner, Laszive, Müßiggänger, Mittagsschläfer, Grillende, Slackliner, Gitarrenspieler, Frisbeespieler, Fahrradfahrer, Naherholer, Punks, Hipster, Rastas, Knutschereien, Fummeleien, Grillfeiereien, Kinderwagen, Müllwegbringer, Fotosessions, Selfiesession, Federball, Fußball, Hol’ den Ball, Bier, Brause, Brezel, Eiscrème. Der Park ist an diesem Tag, an dessen Abend man in den Mai tanzen wird, ein Abbild einer kerngesunden, toleranten, liberalen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die ich in dieser dargebotenen Vielfalt liebe und in der ich aufgehen kann und mag; bunt, offen, liberal. Mein Stück unvermeidlichen Hippiekitsches liegt in der Erfahrung auf Leipzigs Volksparkwiesen.
Es ist auch wieder eine kleine Versöhnung, denn obwohl ich die Erfahrungen dieser Reise schätze und viel lehrreiches über Land, Leute und mich selbst mitnehmen kann, so hat mich Sachsen doch bislang arg verbittert, mitgenommen, erschüttert in seiner kleingeistigen Sorge und Angst. All die abgewendeten Blicke und Körper und die somit entstehende Verschlossenheit, die so nicht in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg zu spüren waren. Leipzig hingegen überstrahlt dieses engstirnig provinzielle Angst-und-Wut-Denken wie eine Metropole – weltoffen und dynamisch – und ist für mich dadurch die einzig wahre Hauptstadt des Ostens von Deutschland.
Dass es auch hier konfrontative Reibung gibt – nicht bloß zwischen mir dahergelaufenem leidenschaftlichem Maßstabsverzerrer und einer versprengten Handvoll bemitleidenswerter Vollgasparanoider – dass diese Konflikte unausweichlich scheinen ab einer gewissen Menge an Menschen und Geisteshaltungen, ahnt man freilich sofort, wenn man auch hier kleine Gruppen an stiernackigen und unmissverständlich tätowierten ganzen Kerlen sieht, denen man mehr zutraut als bloß den Ort des nächsten Bieres auszudiskutieren. Ich spüre aber auch, dass diese Gruppen und ihr Hass in Leipzig wenig Durchsetzungsvermögen haben gegen die geisteswissenschaftliche und offenkundig eher links orientierte Gesinnung dieser Stadt. Ich merke es, wenn ich durch Connewitz laufe, wo man auf eine linke Subkultur trifft, die vor Militanz nicht zurück schrecken wird. Militante Ränder, liberale und tolerante Mitten, bester Nährboden für gesellschaftlichen Austausch und Streitdiskurs auf diversen Ebenen.
Im Zeitgeschichtlichen Forum kann ich mir ein plakatives Bild dieser Meinungsvielfalt machen. Eine Fotoausstellung dokumentiert die Meinungen Leipziger Bürger zu dem Satz „Wir schaffen das“. Der Tenor ist entweder weiß bis mittelgrau bei den Zuversichtlichen, anschließend lese ich ein tiefes Schwarz. Es gibt „Wir schaffen das auf jeden Fall“ und differenziert-optimistische Blicke mit unterschiedlicher Beisetzung an Skepsis und Sorge. Es gibt allerdings kein vielleicht. Da, wo die Neutralität und Unentschlossenheit der optimistischen Fraktion ansetzen würde, beginnt unmittelbar ein „Wir schaffen das auf keinen Fall.“ Ein besonders besorgter Bürger spricht darüber, dass sich bald niemand mehr hinaus auf die Straßen traut. Ich sehe seine Bodybuilderstatur und seinen Blitzkriegblick und weiß, dass er nicht von sich sprechen kann. Wen meint er genau? Wenn er wüsste, dass sowieso kaum jemand hinausgeht, da sie alle ihre Wohnungen abwohnen, ihre Flatrates ausnutzen, Serien schauen und fernsehen müssen, und wenn sie dann doch einmal hinausgehen, jede dreihundert Meter mit ihren Autos fahren müssen, dann könnte er so etwas schwer behaupten. Denn was auch immer die Menschen, von denen er spricht in den vergangenen vier Wochen unternommen haben: Unterwegs in ihren Orten, Städten, Provinzen waren nur sehr wenige von ihnen. Das hätte ich nämlich bemerkt.
Die Einschätzung dieses Fremdenfeindes aus Leipzig zu lesen ist ebenso normal wie befremdlich, unvermeidlich wie bitter. Die ängstlichen und verbitterten Schwarzmaler – man trifft sie überall. Auch in den augenscheinlich vitalsten Städten in Deutschland, Unterwegskultur, Vergnügungsorientiertheit, umarmte Bücher – und Sorgen. Die Stadt schert sich nicht um diese Zweifel, sie schenkt mir eine phantastische Tagesform, Wochenendschleunigung, Sonnenschein, Feiertagsstimmung. Auf dem Augustusplatz finde ich einen Markt, auf dem ich mediterrane Köstlichkeiten erwerbe, Oliven, getrocknete Tomaten, etwas Brot und Kräuterkäse. Verschlingend, schlemmend, in die Sonne blinzelnd sitze ich auf den Treppenstufen vor der Oper und genieße das undeutsche Essen. Wunderschöne junge und junggebliebene Menschen ziehen an mir vorüber, die Art von Stil und Eleganz spazieren tragend, die in den vergangenen Wochen von mir erst schmerzlich vermisst, später dann vergessen wurde. Jetzt ist der positive Schock darüber umso erschlagender für mich – ein Laben in deutscher Schönheit, ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten. Meine Hormone spielen verrückt, ich schaue nicht mehr: Ich starre. Schnell muss ich weiter.
–
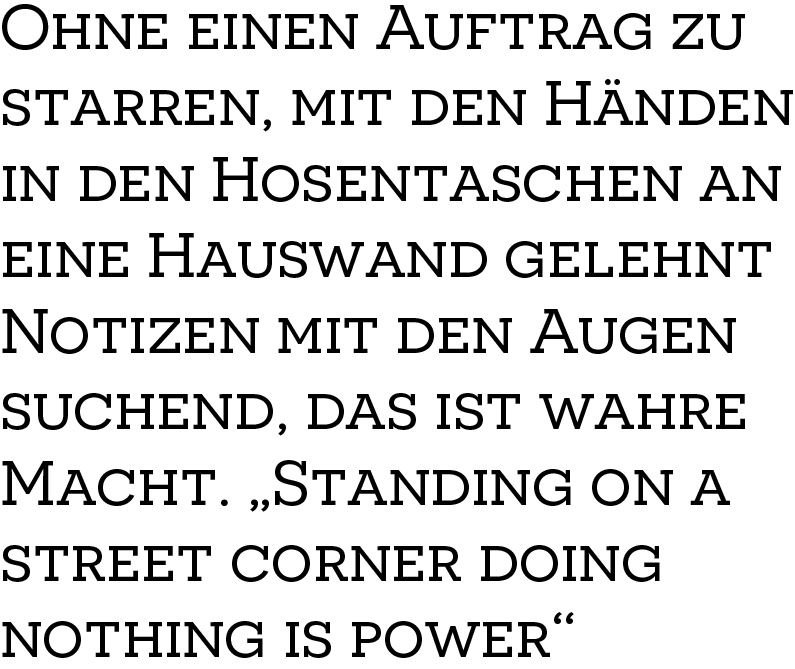 Wieder läuft mein Blues, still und schweigend. Die Sonne knallt auf Leipzig und einen Tag vor dem ersten Mai ist die Stadt, sind die Einwohner und ihre Gäste in einer wundervollen Sektfrühstücklaune. Allermeist: Beschwingte Unterhaltungen, Flirts, Witze, Lachen, Tatschen, mehr Haut, weniger Stoff, lyrische Körpersprachen, während ich als Fliege an der Wand beobachtend und teilnahmslos daneben sitze und den Menschen und Stimmungen meine Noten gebe.
Wieder läuft mein Blues, still und schweigend. Die Sonne knallt auf Leipzig und einen Tag vor dem ersten Mai ist die Stadt, sind die Einwohner und ihre Gäste in einer wundervollen Sektfrühstücklaune. Allermeist: Beschwingte Unterhaltungen, Flirts, Witze, Lachen, Tatschen, mehr Haut, weniger Stoff, lyrische Körpersprachen, während ich als Fliege an der Wand beobachtend und teilnahmslos daneben sitze und den Menschen und Stimmungen meine Noten gebe.
Und dennoch, trotz der plötzlich pulsierenden Einsamkeit möchte ich dies hier gerne für den Rest meines Lebens machen: Zerstreutes und ungeplantes Wandeln durch die Welt, von Impulsen leiten und führen lassen, die Geister und Stimmungen der Städte für mich ergründen, Paare und Passanten beobachten, das Guessing-Game spielen, dabei gut essen, ein Bier trinken, rauchen, interpretieren, alleine und für sich also: mich. Oder aber mit Bekanntschaften des Weges. „Isolation“ ist in der „Radio-Random“-Hitliste ein gern gehörter Hit. Und Isolation, das ist ja auch: Alleine irgendwo zu stehen und entgeistert, glücklich, wortlos in sämtliche Richtungen zu schauen – auf das Grün mit den Menschen darauf, auf die Hauswand mit der Farbe darauf, auf die Straße mit der Bewegung darauf. Oft traut man sich nicht, dieses Geglotze konsequent und penetrant durchzuhalten, man spürt den Druck sich anbahnender Übersprunghandlungen, die dieses „was macht der da?“ im Blick der anderen oder „was mache ich hier?“ im eigenen Selbstverständnis legitimieren oder zumindest kaschieren sollen. Ohne einen Auftrag zu starren, mit den Händen in den Hosentaschen an eine Hauswand gelehnt Notizen mit den Augen suchend, das ist wahre Macht. „Standing on a street corner doing nothing is power“ ist ein Spruch, den ich vor Jahren einmal an einem Haus in Hamburg gelesen habe und der mir seither ein gerne genutztes Motto bietet, die Welt anzustarren ohne dabei eine weitere Ablenkung oder einen tieferen Sinn zu suchen. Einfach glotzen und sich seinen Teil denken, dabei die Antennen neu ausrichten, Körpersprachen versuchen zu interpretieren, Emotionen lesen wollen, nicht telefonieren oder auf einen Bildschirm schauen müssen, sondern den lebendigen Fluss an Menschen um mich herum wahrnehmen. Es ist mir zu einem meiner liebsten Hobbies geworden und ich kann erahnen, wie sehr es zum Lebensinhalt von Schriftstellern, Soziologen, Anthropologen und Flaneuren werden kann.
Ich gehe an einem recht authentischen Punk-Schuppen in Connewitz vorbei. Vor dem Laden stehen zehn Männer, alle sind komplett in schwarz gekleidet und obwohl es mir sehr schwer fällt, ihr Alter zu schätzen, so ist doch klar, dass Jugend und Sturm & Drang, ihre Zeiten der Rebellion, längst vorüber sind. Dennoch stehen sie hier, mit Halbglatzen und Sicherheitsnadeln in den Ohren, zerschlissenen und zerfetzten Klamotten, in einer Wolke aus zotigem Gelächter und bierseliger Laune. Punks mit Haftpflichtversicherung – es hat etwas zutiefst absurdes und war mir schon immer irgendwie fremd. Das Gerülpse und Gezeche wird kurz und abrupt unterbrochen, als ich die Gruppe abmarschiere. Ich nicke zum Gruß und starre in fragende Augen – die Punks wissen nicht im Geringsten, was sie mit mir anfangen sollen, was mir sehr gut liegt. Ich spüre Blicke im Rücken und höre ihre ratlose Stille hinter mir her brüllen.
Hass auf die Polizei („A.C.A.B.“ und „Schweine“ – Schriftzüge an jeder zweiten Hauswand), dazu die ganz klaren Botschaften an die Nazis („Nazis jagen / aufmischen / auf’s Maul!“), linke und verbissene Militanz – sie bleibt mir im Grunde unzugänglich und dennoch vielfach lieber als die Würstchenbudenfaschos oder Putinisten in Dresden. Diese Neigung zur Aggression gegen „die Anderen“ – also die Staatsmacht und die rechte Soße – sorgt wohl auch für den Nimbus dieses Ortes. Man muss es nicht lieben, aber man sollte es schätzen, vor allem wenn man Dresden an einem Montagabend erlebt hat. Es gibt eine Gruppierung, die sich dagegen auflehnt und weiter auflehnen wird, sollten die faschistoiden Zwischenmenschlichkeiten eskalieren. Ist dies nicht irgendwie beruhigend, wenn man an sich ein Menschenfreund ist? Wenn man Bilder sieht von Mobs, die Busladungen verstörter Menschen attackieren oder Unterkünfte in Brand setzen? Wenn es nur eine Frage der Zeit sein kann, bis erste Fremde gelyncht aufgefunden werden? Ich habe den Eindruck, als wäre in solchen Situationen auf eine Stadt wie Leipzig Verlass.
In einem sehr punkigen und veganen Biergarten sitze ich dann inmitten von Ohrentunneln, Dreadlocks und eher ästhetik- als botschaftsorientierten Tätowierungen. Eine junge Frau mit blauen Haaren, die mich auch wegen ihrem Gesicht an die Emma in „Blau ist eine warme Farbe“ erinnert, grinst mich hinreißend und entwaffnend an. Wir kommunizieren über Blicke und Lächeln und ich sollte meine Notizen Notizen sein lassen und zu ihr gehen, doch dann ist sie schon fort, macht Feierabend, huscht davon und ich bin wieder alleine mit meinen glotzenden, bohrenden, ausziehenden Augen. Ich trinke mein Bier und gehe dann hinein in die verdunkelte Bar, in der sehr schnelle Surfmusik live performt wird. Die Band heißt „The Razorblades“ und spielt vor dem typischen German Circle: Fünfzehn eher unschlüssig mit den Füßen wippende sind zu einem Halbkreis um die Bühne herum aufgestellt, eine Hand in den Hosentaschen, die andere am Getränk. Größtmöglicher Kontrast zwischen der funkensprühenden Energie der Band und dem Verhalten des Publikums. Derweil werde ich rasend von der Power der dargebotenen Vorführung, mein Grinsen verselbstständigt sich zu einer grenzdebilen Ausstrahlung. Kontrolle wird gerne aus der Hand gegeben und der Eigendynamik des Tages überlassen. Ich tanze ein paar ausgelassene Runden, den Spazierstock schwingend.
Leben, Leipzig! Lasst euch umarmen!

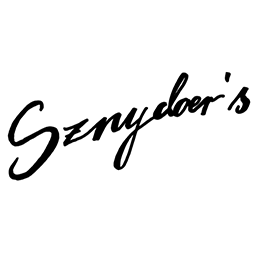



Leave a Reply