MEISSEN – RIESA
–
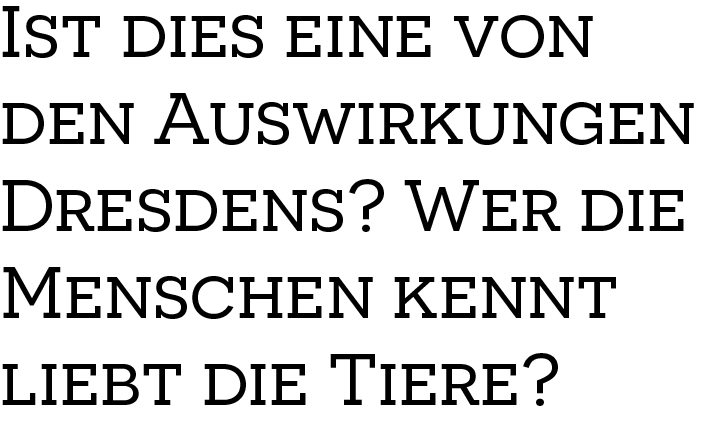 RADIO RANDOM, mein auf Zufallswiedergabe eingestellter MP3 – Player hat eine bestechende Tagesform und schenkt mir pausenlos persönliche Lieblingshits. Wie ein Wahnsinniger – hastend, getrieben und bereitwillig auf einen Provianteinkauf verzichtend – breche ich sehr früh in Meissen auf. Ich folge dem Elberadweg und bleibe auf diesem über dreißig Kilometer vollends alleine und unbehelligt. Ich spüre einen körperlichen Flow und lasse Pausen aus. Beine und Schultern arbeiten wie Maschinen, gleichzeitig ist mein Verstand getrieben von einem Fluchtgedanken, der wiederum durch Unverständnis gespeist wird. Die resolute Lady mit den Heilsteinen hallt nach in meinem Kopf, natürlich auch noch die Plakate aus Dresden. Diese Denke steht in meinen Augen sinnbildlich für all jene, die nicht verstehen können oder möchten, was Solidarität und Empathie bedeuten. Der gut geschminkte, hässliche Deutsche. Ich spüre Zornfalten und schreie deren Gründe hinaus. Tame Impala. The Black Keys. Thee Oh Sees. Das Adrenalin drückt mich weiter am windigen Elbufer entlang, keinerlei Ablenkung oder Unklarheit wird zugelassen, simpel muss es heute bleiben: Fuß vor Fuß, Schritt für Schritt, immer schneller, immer weiter, vorwärts und voran. Und plötzlich, nur fünf Stunden nach meinem Aufbruch aus der Porzellanstadt Meissen, stehe ich vor der Nudelstadt Riesa.
RADIO RANDOM, mein auf Zufallswiedergabe eingestellter MP3 – Player hat eine bestechende Tagesform und schenkt mir pausenlos persönliche Lieblingshits. Wie ein Wahnsinniger – hastend, getrieben und bereitwillig auf einen Provianteinkauf verzichtend – breche ich sehr früh in Meissen auf. Ich folge dem Elberadweg und bleibe auf diesem über dreißig Kilometer vollends alleine und unbehelligt. Ich spüre einen körperlichen Flow und lasse Pausen aus. Beine und Schultern arbeiten wie Maschinen, gleichzeitig ist mein Verstand getrieben von einem Fluchtgedanken, der wiederum durch Unverständnis gespeist wird. Die resolute Lady mit den Heilsteinen hallt nach in meinem Kopf, natürlich auch noch die Plakate aus Dresden. Diese Denke steht in meinen Augen sinnbildlich für all jene, die nicht verstehen können oder möchten, was Solidarität und Empathie bedeuten. Der gut geschminkte, hässliche Deutsche. Ich spüre Zornfalten und schreie deren Gründe hinaus. Tame Impala. The Black Keys. Thee Oh Sees. Das Adrenalin drückt mich weiter am windigen Elbufer entlang, keinerlei Ablenkung oder Unklarheit wird zugelassen, simpel muss es heute bleiben: Fuß vor Fuß, Schritt für Schritt, immer schneller, immer weiter, vorwärts und voran. Und plötzlich, nur fünf Stunden nach meinem Aufbruch aus der Porzellanstadt Meissen, stehe ich vor der Nudelstadt Riesa.
Ich bin irritiert, denn ich sehe noch Kinder in den Schulen und die Sonne hoch am Himmel. Über den Elberadweg erreicht man direkt den Stadtpark und auf dessen Pfaden kommt man direkt vor das Tor des Tierparks. Ich sehe von draußen zwei Kolkraben in einem Käfig sitzen und entscheide mich direkt für einen Besuch, bevor ich mir eine Unterkunft suche. Vor dem Käfig mit den beiden Raben bleibe ich eine gute Stunde sitzen. Das etwas größere Männchen krakeelt ununterbrochen, das Weibchen beobachtet abwechselnd ihn und mich. Die Rufe sind krachend, grell, einschneidend – es ist herrlich und ich möchte beide gerne befreien oder mitnehmen.
Mein Vater hatte als kleiner Junge eine Elster. Sie fiel aus ihrem Nest und er stutzte ihren gebrochenen Flügel, brachte sie durch den Winter. Von da an war es sein Vogel. Sie kreiste die meiste Zeit über ihm und sobald er nach ihr rief, landete sie auf seiner Schulter. Die Elster war äußerst verspielt, sie flog in offenstehende Fenster und riss Fetzen von den Tapeten ab. Sie flog in das Rathaus unserer Kleinstadt, brachte Papierstapel durcheinander und floh unbehelligt mit irgendwelchen Unterlagen im Schnabel. Als die Elster ein Kleinkind in einem Kinderwagen angriff, musste mein Vater seinen Vogel töten. Wenn er darüber spricht, wird er noch heute, beinahe siebzig Jahre danach, traurig und wehleidig. Wann immer ich eine Elster sehe, muss ich an diese Geschichte denken und wünsche mir insgeheim, auch so ein Verhältnis zu einem schlauen Vogel zu haben.
Hier im Tierpark halten sie eine Elster. Gemeinsam mit einem Eichelhäher springt sie hektisch von Ast zu Ast – auffälliges Verhalten. Die beiden Füchse hingegen sind die entspanntesten Tiere vor Ort: Der eine schläft tief und fest, der andere schaut immerhin kurz auf als er meine Schritte hört. Mit verschlafenen Augen schaut er mich kurz an, gähnt, und schlummert weiter. Bevor ich gehe setze ich mich erneut zu den Raben und schaue ihnen noch einige Minuten dabei zu, wie sie mich anstarren.
Ich bin hier bei diesen Vögeln und Füchsen plötzlich beruhigt und im Reinen mit mir und der Welt. Ist dies eine von den Auswirkungen Dresdens? Wer die Menschen kennt liebt die Tiere? Ich liebe auch die Menschen, nicht alle und sicherlich nicht immer, aber nicht wenige von ihnen sind ja tatsächlich zum Verlieben. Jedoch: Eine Hassparolen schreiende Gruppe, die vom Ausrotten und Ausmerzen stumpfsinniert, verliert intellektuell und charismatisch ganz klar gegen diese schwarzen Vögel. Zum Abschied recke ich die linke Faust empor. Es ist albern und vielleicht auch ein bisschen peinlich: Der eingesperrte Vogel, der funktionsbekleidete Wanderer – wo bleibt hier bitte die Anarchie? Die Frage hallt nach auf meinem Weg in die Fußgängerzone.
Die ersten vier Geschäfte der Hauptstraße haben  geschlossen und suchen Nachmieter. Kein gutes Zeichen. Ich finde schnell die Touristeninformation, wo ich mir das Unterkunftsverzeichnis mitnehme und in den erstbesten Dönerimbiss einkehre.
geschlossen und suchen Nachmieter. Kein gutes Zeichen. Ich finde schnell die Touristeninformation, wo ich mir das Unterkunftsverzeichnis mitnehme und in den erstbesten Dönerimbiss einkehre.
Der Wirt erkennt, dass ich nicht von hier stamme. „Ah, Kassel! Große Stadt, viel los! Nicht wie hier, hier ist immer langweilig!“ Da ist es schon wieder – hier ist es immer langweilig. Einige Glatzen marschieren vor dem Schaufenster entlang, erfüllen die ohnehin bejammernswerte Fußgängerzone mit Freudlosigkeit und bösen Blicken. Ich habe einige Schubladen definiert, in die ich die Menschen mittlerweile stecke; die Frisuren und die Nacken, die Kleidermarken und die Körpersprache beim Rauchen und Tätowierungen durch die Gegend tragen, die Schriftzüge an ihren Autos und Gartenzäunen. Ein großer Teil der Offenheit, mit der ich losmarschiert bin, ist verloren gegangen und durch die Erfahrung in Dresden hoffentlich nicht unwiederbringlich von dannen gezogen. Ich versuche wieder, in den Menschen das Gute zu sehen, doch sie machen es mir oft schwer.
Eine dieser Glatzen betritt den Dönerladen. Er setzt sich grußlos an einen Tisch und schaut nicht von seinem Smartphone auf. Der Wirt fragt ihn was er möchte und ohne seinen Blick zu heben bellt der Gast zurück „No, ‘n Döööner halt!“ Das Essen wird ihm an den Tisch getragen, es wird ein guter Appetit gewünscht. Der Gast zeigt nicht die geringste Reaktion; kein Dank, kein Aufblicken, kein Lächeln. Was bist du denn für ein Mensch, denke ich bei mir. Schämst du dich, hier zu essen und quittierst dies mit maßloser Unfreundlichkeit? Wo ist die nächste Metzgerei? Ich werde wütend, was natürlich niemandem, am allerwenigsten mir selbst weiter hilft.
–
Ich schaue mir die Übernachtungsmöglichkeiten in der Broschüre an und melde mich telefonisch bei einer günstigen Pension im Stadtkern. Eine gehetzt wirkende Frau nimmt ab. „Ja, für eine Nacht“ sage ich und sie antwortet: „Naja, wenn sie nicht so dreckig sind und es mir halbwegs sauber hinterlassen…“ „Eigentlich brauche ich nur einen Platz zum schlafen…“ „Eigentlich sehr ungern, aber…“ „Ach, wissen sie was, verdienen sie ihr Geld doch bitte anders.“ Natürlich bin ich dreckig aber ich weiß wie eine Dusche funktioniert und bevor ich nach einer solchen Ansage in dieses Pensionsbettchen krieche, schlafe ich lieber an einem anderen Ort, egal wo.
Bei der nächsten Nummer habe ich mehr Glück. Das Gespräch beginnt zwar ähnlich – „Ja, ich habe noch ein Dreibettzimmer, das können sie für 45€ haben.“
„Aber sie müssen doch bloß ein Bett beziehen…“
„NEIN! Wenn mir heute Abend noch Gäste kommen stehe ich blöd da!“
Natürlich. Wenn heute Abend noch Gäste nach Riesa kommen. Das erscheint freilich sehr wahrscheinlich – nicht. Es wird still am Telefon, doch dann fällt ihm ein, dass er noch ein sehr kleines Zimmer anbieten kann, das gäbe es für 25€. Geht also doch.
An der Pension begrüßt mich der Wirt in Jogginghose mit Brotkrumen und Schmalz in den Mundwinkeln. Er ist hocherfreut – „Ein Wandersmann! Na, hättest du das gleich gesagt!“ Dann was? denke ich. Die Dusche unten im Waschkeller muss ich mir mit ihm teilen und das Zimmer ist wirklich sehr klein, mir jedoch absolut genügend. Ich komme an, lege ab, ziehe mich um und drehe die obligatorische Runde durch die Stadt: Hauptstraßen, Nebenstraßen, Stadtpark, Sehenswürdigkeiten. Nudeln, Riese, Immendorf.
Kurz vor der Feierabendzeit betrete ich einen vietnamesischen Obstladen. Es sind eigentlich Läden für alles, Glühbirnen, Schrauben, Schokolade, Dekoration, Papierwaren, asiatischer Nippes – man findet alles was man brauchen oder nicht gebrauchen kann. Vor allem die Obstsalate haben es mir angetan. Orangen, Melonen, Mangos, Erdbeeren, Ananas, Trauben – vorgeschnitten und in Zitronensaft eingelegt. Wann immer ich eine erwerben kann, atme ich die Stückchen förmlich ein. Es schaut ein wenig dubios und gefährlich aus, wie der Ladenbesitzer mit einer Bohrmaschine an einem Durchgang zum Hinterzimmer werkelt. Ich hoffe dass es gut ausgeht. Wir kommen über den üblichen Smalltalk ins Gespräch, „Funktioniert’s?“ „Nein, will nicht richtig. Muss aber, bald ist Feierabend…“ undsoweiter. Ich möchte einen Obstsalat und Bananen für den nächsten Tag kaufen. Er sagt, ich solle noch die zweite vom Tage übriggebliebene Obstschale mitnehmen und macht mir dafür einen unfassbar günstigen Preis. Ich nehme beide und runde den Betrag auf. Gegenseitige Blicke in die Augen, Lächeln, „Vielen Dank, junger Mann!“ „Und ihnen viel Erfolg mit der Bohrmaschine!“ Lachen, Winken, Herzlichkeit. Danke.
Vor der Türe: Ein Dreiergrüppchen fies dreinblickender junger Männer, die ihre Spucke in einer Kooperation zwischen ihren amerikanischen Turnschuhen zu einem kleinen See formen. Sie sehen aus, als wäre es nicht unmöglich, dass sie noch nie in ihrem Leben gelächelt haben. Ihre Lage ist auch sehr ungünstig: Sie wollen Bier trinken und müssen dies bei dem Vietnamesen kaufen, der das einzige noch geöffnete Geschäft in der Innenstadt besitzt.
–
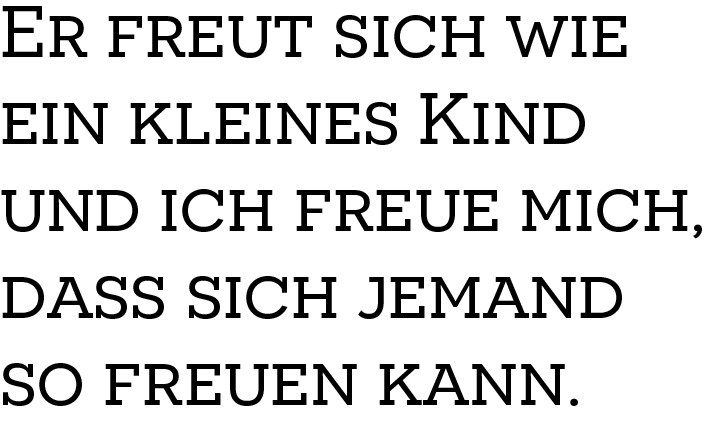 Ich gehe zurück zur Pension um dort zu essen. Der Wirt sitzt alleine neben einem Kaminfeuer und surft auf seinem Tablet. Ich bin der einzige Gast. Das Restaurant ist ein Unikat und Kleinod. Sämtliche Wände sind dekoriert mit Utensilien aus der Kaiserzeit, preußische Folklore soweit das Auge sehen kann. Zeichnungen, Gemälde, Uniformen, Kanonenkugeln, Hüte, Säbel. Der Wirt ist neugierig, er möchte wissen wie meine Strecke verläuft und was ich mir verspreche von dieser Reise. Ich berichte von meinen Eindrücken über dieses Land, was ich bisher erlebt und gesehen habe, spreche über die Sorgen, die man sich derzeit machen kann und die für mich Auslöser für diese Reise darstellten. Seine Augen leuchten. Mein Weg und Auswertungskonzept scheint einer seiner Lebensträume zu sein, er ist ein Reisender und Geschichtenerzähler. Und damit beginnt er nun. Er gibt mir eine endlose Kassette über seine Leidenschaften: Da hinten, das ist ein Stück der Originaltapete aus dem Raum, in dem Napoleon die Friedensbedingungen unterzeichnet hat. Dort drüben ein Originalsplitter von dem Stuhl, auf dem Bismarck einst gesessen hat. Oben liegen noch siebzehn Originalfotos von Humboldt. Dort! „Schau’ es dir genau an, Junge!“ – Der Sommerhut vom Kaiser, ein Original natürlich, „wer sollte so etwas schon fälschen?“ In der Vitrine daneben ist ein Bild vom Kaiser, wie er eben diesen Hut trägt. Ein makelloses Exponat. Endlos lange ist er diesen Reliquien hinterher gereist. Ich lasse mein Essen gerne stehen und kalt werden und mich von ihm durch sein Museumsrestaurant führen. Schwarz-Weiß-Rot getüncht ist alles hier, Pickelhauben, Kaiser-Wilhelm-Bärte, Preußens Glanz und Gloria. Der Kaiser! Immer wieder der Kaiser – er durfte einst einen Kranz an seinem Grab niederlegen. Auf gut Glück ist er an Wilhelms Geburtstag nach Holland an dessen Gruft gereist und hat telefonisch seitens der Hohenzollern eine Ausnahmegenehmigung erhalten. Bei diesem Augenleuchten verwundert dies nicht, es stand ein Fan und Fanatiker vor dem Grab und wollte seinen Dank aussprechen und Respekt bekunden. Unvorstellbar wäre, wie er mit einem Funken dieser Begeisterung von der Kanzlerin oder dem Bundespräsidenten spricht. Zwischenzeitlich redet er in Zitaten: „Die erste Generation schafft Vermögen, die zweite verwaltet Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte, und die vierte verkommt.“ (Bismarck). Es ist schwierig zu sagen, wie er selbst darüber denkt, denn er hätte offensichtlich gerne Kunst oder Kunstgeschichte studiert, anschließend Kunst produziert oder Selbstverwirklichung als Historiker gesucht. Jedenfalls würde ihm dies sehr gut stehen. Er besitzt auch eine Visitenkartensammlung im mittleren vierstelligen Bereich, sammelt grundlegend alles, schmeißt kaum etwas weg. Er verbringt eine hektische halbe Stunde damit, eine bestimmte Visitenkarte zu suchen, um mir einen Kontakt zu vermitteln, mit dem ich ehrlich gesagt sehr wenig anzufangen wüsste. Er lässt sich dennoch nicht davon abbringen – „irgendwo muss das verflixte Ding doch sein! Zur Not schaue ich gleich oben in meinem Archiv nach!“ – erzählt dazu munter weiter seine unterhaltsamen Anekdoten, hat kein Problem mit Angriffsfläche und offenbart persönliche Ansichten, lacht viel, spricht emotional und leidenschaftlich. Er reist viel und fertigt Diavorträge an, die er anschließend in seiner Gastwirtschaft präsentiert und ausstellt. Ich mag ihn und seine begeisterte Art sehr gerne, sie wirkt erfrischend auf mich und irgendwie untypisch deutsch in ihrer leidenschaftlich-kindlichen Begeisterung.
Ich gehe zurück zur Pension um dort zu essen. Der Wirt sitzt alleine neben einem Kaminfeuer und surft auf seinem Tablet. Ich bin der einzige Gast. Das Restaurant ist ein Unikat und Kleinod. Sämtliche Wände sind dekoriert mit Utensilien aus der Kaiserzeit, preußische Folklore soweit das Auge sehen kann. Zeichnungen, Gemälde, Uniformen, Kanonenkugeln, Hüte, Säbel. Der Wirt ist neugierig, er möchte wissen wie meine Strecke verläuft und was ich mir verspreche von dieser Reise. Ich berichte von meinen Eindrücken über dieses Land, was ich bisher erlebt und gesehen habe, spreche über die Sorgen, die man sich derzeit machen kann und die für mich Auslöser für diese Reise darstellten. Seine Augen leuchten. Mein Weg und Auswertungskonzept scheint einer seiner Lebensträume zu sein, er ist ein Reisender und Geschichtenerzähler. Und damit beginnt er nun. Er gibt mir eine endlose Kassette über seine Leidenschaften: Da hinten, das ist ein Stück der Originaltapete aus dem Raum, in dem Napoleon die Friedensbedingungen unterzeichnet hat. Dort drüben ein Originalsplitter von dem Stuhl, auf dem Bismarck einst gesessen hat. Oben liegen noch siebzehn Originalfotos von Humboldt. Dort! „Schau’ es dir genau an, Junge!“ – Der Sommerhut vom Kaiser, ein Original natürlich, „wer sollte so etwas schon fälschen?“ In der Vitrine daneben ist ein Bild vom Kaiser, wie er eben diesen Hut trägt. Ein makelloses Exponat. Endlos lange ist er diesen Reliquien hinterher gereist. Ich lasse mein Essen gerne stehen und kalt werden und mich von ihm durch sein Museumsrestaurant führen. Schwarz-Weiß-Rot getüncht ist alles hier, Pickelhauben, Kaiser-Wilhelm-Bärte, Preußens Glanz und Gloria. Der Kaiser! Immer wieder der Kaiser – er durfte einst einen Kranz an seinem Grab niederlegen. Auf gut Glück ist er an Wilhelms Geburtstag nach Holland an dessen Gruft gereist und hat telefonisch seitens der Hohenzollern eine Ausnahmegenehmigung erhalten. Bei diesem Augenleuchten verwundert dies nicht, es stand ein Fan und Fanatiker vor dem Grab und wollte seinen Dank aussprechen und Respekt bekunden. Unvorstellbar wäre, wie er mit einem Funken dieser Begeisterung von der Kanzlerin oder dem Bundespräsidenten spricht. Zwischenzeitlich redet er in Zitaten: „Die erste Generation schafft Vermögen, die zweite verwaltet Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte, und die vierte verkommt.“ (Bismarck). Es ist schwierig zu sagen, wie er selbst darüber denkt, denn er hätte offensichtlich gerne Kunst oder Kunstgeschichte studiert, anschließend Kunst produziert oder Selbstverwirklichung als Historiker gesucht. Jedenfalls würde ihm dies sehr gut stehen. Er besitzt auch eine Visitenkartensammlung im mittleren vierstelligen Bereich, sammelt grundlegend alles, schmeißt kaum etwas weg. Er verbringt eine hektische halbe Stunde damit, eine bestimmte Visitenkarte zu suchen, um mir einen Kontakt zu vermitteln, mit dem ich ehrlich gesagt sehr wenig anzufangen wüsste. Er lässt sich dennoch nicht davon abbringen – „irgendwo muss das verflixte Ding doch sein! Zur Not schaue ich gleich oben in meinem Archiv nach!“ – erzählt dazu munter weiter seine unterhaltsamen Anekdoten, hat kein Problem mit Angriffsfläche und offenbart persönliche Ansichten, lacht viel, spricht emotional und leidenschaftlich. Er reist viel und fertigt Diavorträge an, die er anschließend in seiner Gastwirtschaft präsentiert und ausstellt. Ich mag ihn und seine begeisterte Art sehr gerne, sie wirkt erfrischend auf mich und irgendwie untypisch deutsch in ihrer leidenschaftlich-kindlichen Begeisterung.
Nun zeigt er mir Aufnahmen von einem Madonna-Konzert, ungeahnte HD-Schärfe, „heißes Teil auch in dem Alter noch.“ Ich esse meine inzwischen kalten, dennoch phantastisch-fettigen Tintenfischringe und schaue mir die weitestgehend nackten Tänzerinnen der Madonna-Show an. Gut gehalten, ja, klar.
Er interessiert sich für „Steine“ wie er sagt – Geschichte und die Orte, an denen sie einst stattgefunden hat. Er zeigt mir noch dieses und jenes, bis ich nichts mehr aufnehmen kann. Das Fett und das Bier liegen schwer in meinem Magen, der Kaiser haut mit Input von oben drauf – ich muss ins Bett. Beim Verlassen des Lokals bemerke ich dann den Ork, eine lebensgroße und realistisch designte Bösewichtfigur aus den „Herr der Ringe“ Büchern und Filmen. Alles hier in diesem Lokal ist auf das alte, vergangene deutsche Kaiserreich aufgebaut und neben der Eingangstür steht dieses gigantische Phantasiewesen in seiner vollkommenen Hässlichkeit. Wohin die nächste Reise für ihn gehe, möchte ich wissen und er antwortet wie aus der Pistole geschossen: „Neuseeland, Herr der Ringe Tour über die ganze Insel!“ Er freut sich wie ein kleines Kind und ich freue mich, dass sich jemand so freuen kann.
Am nächsten Morgen bin ich auch zum Frühstück der einzige Gast. Ich werde mit „Junge“ und einem Klopfen auf die Schulter empfangen. Wir sitzen so wie gestern Abend, ich am Tisch krümelnd, er mir gegenüber erzählend. Heute Morgen geht es um das System, ein kleiner Aufreger über die Presse rutscht ihm heraus – „man weiß doch nicht, wem man von denen in den Medien trauen kann.“ Er liest keine Zeitungen und Magazine, er hat gut informierte Kreise im Internet, denen er sein Vertrauen schenkt, von denen er seine Informationen erhält. Aha. Es ist zu früh für Protest und subjektive Besserwisserei. Wir gehen als Freunde auseinander. Ich bin selten so begeistert unterhalten worden und wünsche ihm für sämtliche Reisen zu Steinen und Gräbern alles erdenklich Gute.
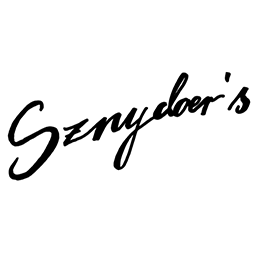



Leave a Reply