DRESDEN – MEISSEN
–
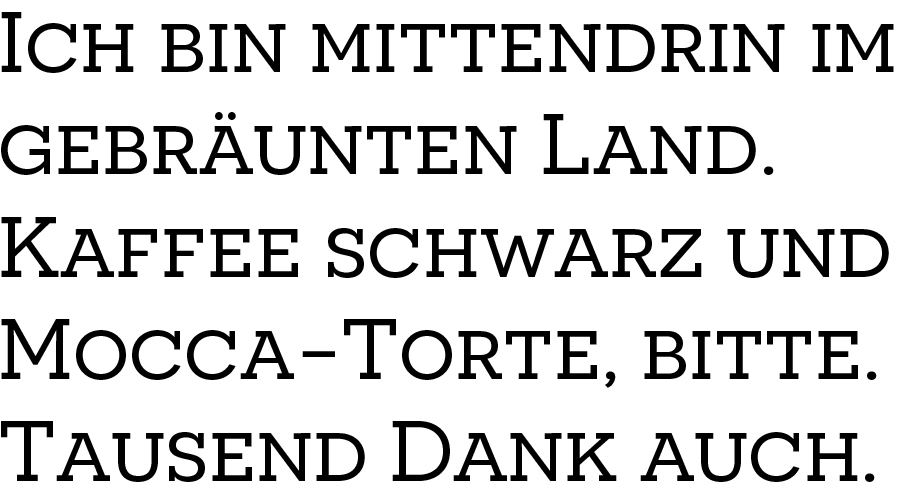
Die Zeit des gemütlichen Gehens scheint vorbei.
Ich renne Richtung Meissen, hoffentlich, ungefähr, Hauptsache: Weiter und weg. Von der Dresdner Neustadt aus Diagonalen ziehend, weitestgehend planlos aber immerhin westwärts durch die mir gestern beschriebenen provinziellen Strukturen mäandernd, die tatsächlich schlumpfhausig nur wenige Fußminuten von meinem Hotel entfernt beginnen, schließlich durch verregnete und förmlich fassbar grüne Waldareale, den Schritt am Anschlag, schnaufend und angespannt und ein wenig wie ein Tier auf der Flucht, so entkomme ich Dresden.
Konstant und vergeblich versucht eine lange, weiche Blende wie nach dem Ende einer Filmmontage, diesen gestrigen Tag anhand eines langen, sanften Übergangs in den heutigen zu schneiden. Dass ein harter, nüchterner Schnitt nicht zu erwarten sein würde erschien logisch. Doch die Heftigkeit, mit der dieser Dresdner Montag immer wieder in den heutigen Tagesfilm einbricht fühlt sich wie ein Fehler an, als würde der Datenträger springen und stottern. Ganz klar: Meine Wahrnehmung ist angekratzt, verschmiert, beschädigt. Glaube ich mich im Heute zu fühlen – die Stille im Wald, ein Reh nur wenige Meter neben mir, wie es plötzlich in langen Sprüngen flieht, dann plötzlich Radebeul – kommt immer wieder der gestrige Mob vor mein Auge krakeelt. Selten habe ich mir so sehr einen Filmriss gewünscht.
Welche von beiden Möglichkeiten ich den Menschen, die mir begegnen, mehr vorwerfe – dass sie entweder bei den faulenden Seelen mitmarschiert sind oder auf der anderen Seite weder Gesicht noch Haltung gezeigt haben – kann ich nicht sagen. Im Sinne der teilnehmenden Beobachtung hat dieser Montag in Dresden jedenfalls für einige Befangenheit bei mir gesorgt.
Zwischenzeitlich stürmt es und der starke Regen fliegt mir frontal ins Gesicht. Mitten auf der freien Fläche stehe und gehe ich, nichts gäbe es um Schutz zu suchen, also muss ich weiter. Der Regen wird zum Vorhang. Radebeul, Trostlosigkeit in grau, ein Meer aus Pfützen und angespannten Gesichtern. Lachen höre ich heute ausschließlich vor einer Berufsschule, Rauchereckenstimmung, Pausengefühle. Weiter geht’s.
In Meissen lässt sich dann immerhin die Sonne blicken. Ich betrete ein Café, über dem auch Zimmer vermietet werden. Die schnatternde Seele einer Bedienung ist allerdings alleine und kann mir erst für den Abend einen Raum herrichten. Mein Gepäck kann ich aber bereits ablegen. Beim Blick in die Zeitung lese ich vom Meissener Sprengstoffanschlag und einer Verhandlung in Heidenau. Ich bin mittendrin im gebräunten Land. Kaffee schwarz und Mocca-Torte, bitte. Tausend Dank auch.
Wohin jetzt mit mir hier in Meissen? Es ist erst Nachmittag, ich habe noch Kraft und benötige etwas versöhnliches.

Ich besuche verhältnismäßig oft Zoos.
Man kann dort seine Achtung vor den Tieren behalten und eine gewisse Abneigung der menschlichen Spezies gegenüber ausbilden. Wenn ich alleine und wortlos durch einen Zoo laufe, frage ich mich oft, auf welcher Zaunseite sich hier zur Schau gestellt wird. Anmut und Formvollendung finde ich jedenfalls häufiger innerhalb der abgesperrten Bereiche.
Hier in Meissen bin ich der einzige Gast und der Zoo entspricht eher einem erweiterten Bauernhof mit ungewöhnlich vielen Vögeln. Streichelzooatmosphäre – genau das richtige nach diesem Tag voller Menschen, die Angst vorm Schmusen haben.
Ich finde die Esel, wegen denen ich überhaupt erst hierher gekommen bin. Wundervolle Tiere, genügsam, gelassen, entspannt und unterschätzt. Nach einer Stunde mit ihnen fühle ich mich wieder, ja, wie denn genau? Wie ein Mensch? Ich fühle mich jedenfalls besser als vor der Begegnung mit den Langohren. Die vier haben mich wieder etwas mit meiner Rasse versöhnt, eine passive Tat, die ich ihnen nicht hoch genug anrechnen kann.
Auf dem Rückweg in die Meissener Altstadt sehe ich zwei Flüchtlinge dort am Ufer sitzen, wo die Triebisch in die Elbe fließt. Von der Brücke aus nicke ich ihnen zu und sie winken mich hinunter. Die beiden trinken Bier und bieten mir ein paar Schlücke an. Wir grinsen viel und sagen uns nur das Notwendigste. Ob sich die beiden hier wie in einem düsteren Landstrich fühlen oder sich angekommen wähnen in ihrem Sehnsuchtsland, darüber können wir uns nicht verständigen. Sie wirken: Entspannt. Ungläubig. Zuversichtlich. Ich bin sehr dankbar für ihre Einladung und die paar geteilten Augenblicke. Sie sagen Goodbye und ich wünsche Good Luck.
–
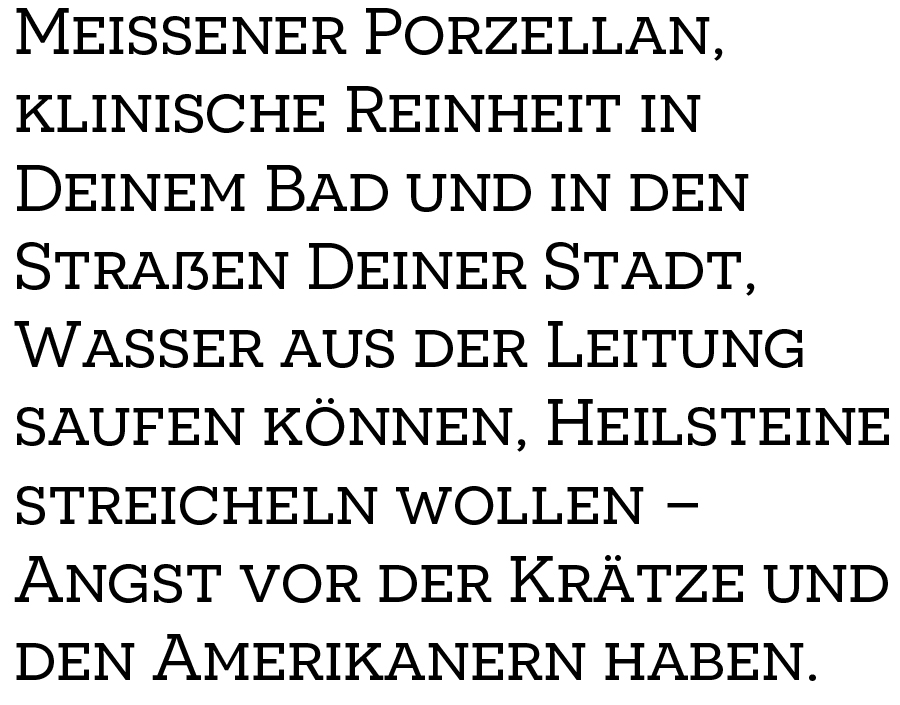 Beschwingt von dieser Begegnung durchstreife ich Meissen kurz vor dem Feierabend der Geschäfte. Ich finde einen kleinen Laden, in dem Heilsteine, Räucherstäbchen, Modeschmuck und mehr derartiges verkauft wird. Ich kaufe hier die teuerste Wandernadel der Reise und komme über deren Erwerb in ein Gespräch mit der Ladenbesitzerin. Die Brotkrumen meiner Reise, die ich für sie verstreue, wecken ihr Interesse. Sie setzt ihre Brille ab, kreuzt die Arme beim Anlehnen an ihren Kassentisch und signalisiert mir somit, mehr hören zu wollen. Gerne. Um Neutralität bemüht, rede ich von den Sorgen, die sich die Bürger machen, und die ich mir mache. Ich erzähle ihr, dass ich am Tag zuvor in Dresden gewesen bin und die Atmosphäre dort verstörend und aggressiv auf mich gewirkt habe. „Aber die waren doch friedlich gestern bei ihrem Lauf, oder?“ fragt sie, mir langsam auf die Schliche kommend. In ihrer Stimme klingt tief verankertes Verständnis für die Marschierenden mit. Sie stellt sich hier und jetzt mit ihrer Körperhaltung und ihrer Argumentation rechtfertigend vor den stumpfen Mob, der gestern Lutz Bachmann zugejubelt hat. Auch sie hat nun einige Argumente: Ihre Positionen sind unmissverständlich und je mehr Plattitüden sie mir entgegen schleudert, desto schwieriger wird es, sachlich zu bleiben. Sie spricht von den Krankheiten, die jetzt mit eingeschleppt werden. Krätze. Aids. Die Pest. Aus ihrem bunt und freundlich geschminkten Gesicht pressen sich die Hassphrasen der PEGIDA-Flyerbotschaften und der Compact-Hetze. Über die erschlagende Überzahl der jungen Männer unter den Geflüchteten und dass diese teilweise aus Urlaubsregionen hierher kämen, weiß sie sich besonders aufzuregen. Warum diese Menschen Smartphones besitzen, obwohl es ihnen doch angeblich so elend ginge, fragt sie mich. Warum sie ihre Familien zurück lassen, möchte sie wissen. Sie spricht über den Schuldigen, der für sie ja bereits feststeht: Der große Bruder! Die USA haben doch alles verbockt! Die sollen das mal schön ausbaden! Was haben wir in Deutschland denn damit zu tun, wenn in Syrien Krieg ist! Meine Gegenfrage: Was hatten die Amerikaner damit zu tun, als Europa in Flammen stand? Wieso fällt es heute so leicht, den USA für alles die Schuld zu geben? Wenn sie in Afghanistan und dem Irak eingreifen ist dies verkehrt. Wenn sie in Syrien nicht eingreifen, ist dies auch verkehrt. Die komplizierte und ambivalente Lage in der Welt- und Geopolitik, die auch Diplomaten und Regierungen in Erklärungsnöte bringt, ist für eine schwarz-weiße Denke zwar gänzlich ungeeignet, befeuert jedoch die Pessimisten und Teufel-an-die-Wand-Maler. Diejenigen, die stets gegen „die da oben“ wettern, und nun anhand der dargebotenen Hilflosigkeit – wer kämpft in Syrien eigentlich gegen wen? Und warum eigentlich? – die Apokalypse nahen sehen. Angst, Lethargie, Pessimismus, Biedermeier – alles ist vereint in dieser einen Frau zwischen ihrem bunten, überteuerten KrimsKrams. Wie kann man ihre Denkkruste nun lockern, wie mit Fundamentalisten diskutieren?
Beschwingt von dieser Begegnung durchstreife ich Meissen kurz vor dem Feierabend der Geschäfte. Ich finde einen kleinen Laden, in dem Heilsteine, Räucherstäbchen, Modeschmuck und mehr derartiges verkauft wird. Ich kaufe hier die teuerste Wandernadel der Reise und komme über deren Erwerb in ein Gespräch mit der Ladenbesitzerin. Die Brotkrumen meiner Reise, die ich für sie verstreue, wecken ihr Interesse. Sie setzt ihre Brille ab, kreuzt die Arme beim Anlehnen an ihren Kassentisch und signalisiert mir somit, mehr hören zu wollen. Gerne. Um Neutralität bemüht, rede ich von den Sorgen, die sich die Bürger machen, und die ich mir mache. Ich erzähle ihr, dass ich am Tag zuvor in Dresden gewesen bin und die Atmosphäre dort verstörend und aggressiv auf mich gewirkt habe. „Aber die waren doch friedlich gestern bei ihrem Lauf, oder?“ fragt sie, mir langsam auf die Schliche kommend. In ihrer Stimme klingt tief verankertes Verständnis für die Marschierenden mit. Sie stellt sich hier und jetzt mit ihrer Körperhaltung und ihrer Argumentation rechtfertigend vor den stumpfen Mob, der gestern Lutz Bachmann zugejubelt hat. Auch sie hat nun einige Argumente: Ihre Positionen sind unmissverständlich und je mehr Plattitüden sie mir entgegen schleudert, desto schwieriger wird es, sachlich zu bleiben. Sie spricht von den Krankheiten, die jetzt mit eingeschleppt werden. Krätze. Aids. Die Pest. Aus ihrem bunt und freundlich geschminkten Gesicht pressen sich die Hassphrasen der PEGIDA-Flyerbotschaften und der Compact-Hetze. Über die erschlagende Überzahl der jungen Männer unter den Geflüchteten und dass diese teilweise aus Urlaubsregionen hierher kämen, weiß sie sich besonders aufzuregen. Warum diese Menschen Smartphones besitzen, obwohl es ihnen doch angeblich so elend ginge, fragt sie mich. Warum sie ihre Familien zurück lassen, möchte sie wissen. Sie spricht über den Schuldigen, der für sie ja bereits feststeht: Der große Bruder! Die USA haben doch alles verbockt! Die sollen das mal schön ausbaden! Was haben wir in Deutschland denn damit zu tun, wenn in Syrien Krieg ist! Meine Gegenfrage: Was hatten die Amerikaner damit zu tun, als Europa in Flammen stand? Wieso fällt es heute so leicht, den USA für alles die Schuld zu geben? Wenn sie in Afghanistan und dem Irak eingreifen ist dies verkehrt. Wenn sie in Syrien nicht eingreifen, ist dies auch verkehrt. Die komplizierte und ambivalente Lage in der Welt- und Geopolitik, die auch Diplomaten und Regierungen in Erklärungsnöte bringt, ist für eine schwarz-weiße Denke zwar gänzlich ungeeignet, befeuert jedoch die Pessimisten und Teufel-an-die-Wand-Maler. Diejenigen, die stets gegen „die da oben“ wettern, und nun anhand der dargebotenen Hilflosigkeit – wer kämpft in Syrien eigentlich gegen wen? Und warum eigentlich? – die Apokalypse nahen sehen. Angst, Lethargie, Pessimismus, Biedermeier – alles ist vereint in dieser einen Frau zwischen ihrem bunten, überteuerten KrimsKrams. Wie kann man ihre Denkkruste nun lockern, wie mit Fundamentalisten diskutieren?
Stichwort: Solidarität. Hat sie mal aus der Fensterfront ihres Ladens geschaut und sich in Erinnerung gerufen, wie all diese Modellstadtstraßenzüge noch vor dreißig, vierzig Jahren aussahen? Hat sie, ja, „das hat man schön wieder aufgebaut.“ „Man“ also – Aha.
Stichwort: Verantwortung. Kann sie sich vorstellen, dass es eine geschichtliche Bringschuld gibt? Dass wir in Deutschland womöglich dankbar dafür sein sollten, eines der reichsten und stabilsten Länder zu sein, obwohl wir der Welt Dinge wie den Nationalsozialismus und Konzentrationslager beschert, und damit das nicht gerade neuzeitliche Phänomen des Genozid auf ein unübertroffenes Level gehoben haben? Wie denkt sie darüber, dass uns nach, nunja, „unruhigen Zeiten“ geholfen wurde?
„Da haben wir uns selbst herausgezogen! Trümmerfrauen! Wirtschaftswunder!“ sagt sie und ich verliere alles, was hilfreich wäre: Hoffnung, Zuversicht, Toleranz. Still verzage ich und weiß nicht mehr weiter. Sie durchbricht die Stille. „Ja, und dass man nun auch schon nicht mehr in die Türkei fahren kann, wegen dieser ganzen Politik-Sache, das finde ich auch schlimm.“ Du Seelchen, denke ich. Meissener Porzellan, klinische Reinheit in Deinem Bad und in den Straßen Deiner Stadt, Wasser aus der Leitung saufen können, Heilsteine streicheln wollen – Angst vor der Krätze und den Amerikanern haben. Sie wünscht mir alles Gute, trotz allem gegenseitigen Gereibe. „Wissen sie, ich bin am Ende des Tages auch einfach nur froh, dass wir noch nicht den dritten Weltkrieg haben und ich friedlich in meinem Bettchen liege.“ Das sagt sie so zum Abschied. Manchmal kann man nicht so viel essen, wie man kotzen möchte.
–
Essen muss ich nun dennoch etwas. Ich steige hinauf 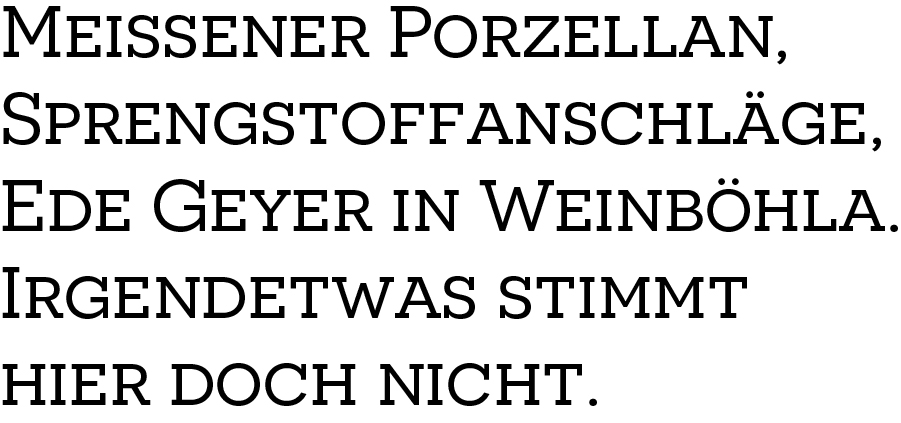 zum Dom und nehme in einem Restaurant Platz, dass für meinen Aufzug deutlich zu chic ist. Egal, keine Angst vor Schmerzgrenzen. Mir eröffnet sich der Blick durch eine riesige Fensterfront über die Altstadt, wie sie den Gästen hier zu Füßen liegt. Feinstes Besteck, stilvolles und unaufdringliches Klaviergeklimper, viel Etikette. Eine einsame und sehr junge Bedienung kämpft sich durch sämtliche Bestellungen, leiser und vornehmer Ton ihrerseits, sie ist freundlich und zuvorkommend bis ins Mark. Auch sie hat eine provokante Farbsträhne in ihrem Haar, neben mir in meiner Wandermontur ist es das einzige, was nicht wirklich an diesen Ort passen möchte. Somit solidarisiere ich mich mit ihr. Gegen die allumfassende visuelle Harmonie, gegen den glatten Knigge um uns herum. Ihre Haare strahlen dagegen, mein Körper müffelt dagegen an.
zum Dom und nehme in einem Restaurant Platz, dass für meinen Aufzug deutlich zu chic ist. Egal, keine Angst vor Schmerzgrenzen. Mir eröffnet sich der Blick durch eine riesige Fensterfront über die Altstadt, wie sie den Gästen hier zu Füßen liegt. Feinstes Besteck, stilvolles und unaufdringliches Klaviergeklimper, viel Etikette. Eine einsame und sehr junge Bedienung kämpft sich durch sämtliche Bestellungen, leiser und vornehmer Ton ihrerseits, sie ist freundlich und zuvorkommend bis ins Mark. Auch sie hat eine provokante Farbsträhne in ihrem Haar, neben mir in meiner Wandermontur ist es das einzige, was nicht wirklich an diesen Ort passen möchte. Somit solidarisiere ich mich mit ihr. Gegen die allumfassende visuelle Harmonie, gegen den glatten Knigge um uns herum. Ihre Haare strahlen dagegen, mein Körper müffelt dagegen an.
Im Restaurant speisen Menschen mit Geld und Sinn für die schönen Dinge. Ein Paar, dass den Wein und das Essen so dermaßen genießt, sich so tief in die Augen schaut, zulächelt, Glück und Zufriedenheit ausstrahlt – sie müssen etwas feiern und ich komme nicht umher mir vorzustellen, was für eine phantastische Nacht sie haben werden, wenn sie nicht zu viel vom Wein kosten. Ich freue mich für sie und an ihnen.
Zwei stilvolle Ladies sind vertieft im hochakademischen Gespräch. Jedes Wort wird bewusst gewählt und pointiert gesetzt. Sprache, Körpersprache: Etikette.
Daneben sitzt ein Paar, das das Kunststück aufführt, in eineinhalb Stunden kein einziges Wort miteinander zu reden.
Hinter mir am Tisch essen zwei ältere Paare, eines aus Tschechien, eines hier aus der Region. Sie besuchen sich in unregelmäßigen Abständen gegenseitig und befinden sich in einem herzlichen Gespräch. Das Bildnis von Louise Otto-Peters hängt an der Wand und die Paare erkundigen sich bei der Pinkgesträhnten nach ihr. Diese gibt bereitwilligst Auskunft über die Frau, die in Meissen geboren und später zu einer Frauenrechtlerin wurde. „Was ist denn eine Frauenrechtlerin?“ fragt der deutsche Mann seine Frau.
Nach diesem fürstlichen Essen wandere ich weiter durch Meissen, blaue Stunde, Menschenleere. Pittoreske Ödnis, sich selbst überlassene Fußgängerzonen. Alle paar Minuten sieht man einen oder zwei Japaner, hört ein Gespräch auf Tschechisch oder das breite Singsang des amerikanischen Englisch. Ich frage mich, wie man die Deutschen dazu bekommt, hinaus zu gehen, zurück zum Beton, wo die guten Stuben einladend sind und bereit stehen für Leben in den Straßen, für Geselligkeit und soziale Reibung. Außerdem in Meissen: Fleischereien soweit das Auge zu blicken vermag.
Am Tag zuvor hat mir der Herr auf der Gegendemo erklärt, dass diese Fleischereikultur ein Definitionsmerkmal der Rechten sei. „Spätzle statt Döner“ fiel mir umgehend ein und nun auf, wie viele Fleischereien, Metzgereien, Wurstgeschäfte hier in Sachsen zu finden sind. Hinter jeder Glaswand mit aufgedrucktem, erbärmlich gestalteten aber glücklichen Schweinchen, vermute ich nun den deutschen Gruß – Dresden hat mich paranoid gemacht. Dagegen hilft natürlich erst einmal ein Bier, Reflexion, Feierabendstimmung, andere Menschen anstarren, Eindrücke niederschreiben.
Ich finde eine Schankstube. Reges Leben herrscht, angenehme Lautstärke, Geselligkeit, lautes Lachen. Ablenkung. Ich lese hier „Elbgeflüster – Das Lifestyle-Magazin für den Landkreis Meissen“. Auf dem Cover findet sich der moderne Cowboy, eine Art Kai Wiesinger wie er Ende der 90er Jahre ausgesehen hat, die Haut gephotoshopt bis zur absoluten Makellosigkeit, Pilzsammlerhut, Schwiegermuttergrinsen, makellos getrimmter Fünf-Tage-Bart, in der Hand ein Korb Gemüse, vermutlich alles Bio. Der Titel: „Du und dein Garten!“ Ferner:
„18! Gewinnspiele!“
„Paul Panzer kommt nach Riesa!“
„Interview mit Semino Rossi“ (ohne Ausrufezeichen)
„Wer wird das Indigo-Girl 2016?“
„Trainer-Legende Eduard Geyer im Zentralgasthof Weinböhla.“
„Tractor-Pulling: Großer Preis von Deutschland.“
Meissner Porzellan, Sprengstoffanschläge, Ede Geyer in Weinböhla. Irgendetwas stimmt hier doch nicht. Ich denke an die beiden Flüchtlinge heute Nachmittag und daran, wie sie ihr Grinsen behalten haben. Ich verneige mich innerlich in tiefer Ehrfurcht und Respekt vor ihrer dicken Haut und bestelle noch ein Bier.
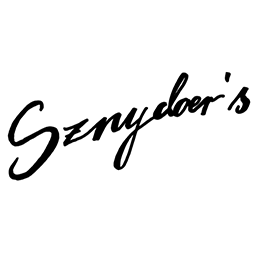



Leave a Reply