SÄCHSISCHE SCHWEIZ
–

Oft in den vergangenen Wochen habe ich mich gefragt: Deutschland, bist du schön? Ich denke an die ästhetische Schönheit, Streicheleinheiten für die Augen, weite und erfüllende Blicke, Caspar-David-Friedrich-Schönheit, monumentale Alpenschönheit, Hamburger Industrieromantikschönheit, Brücken, Seen, Berge, Wälder, Nebelschwaden zwischendrin, pittoreske Winkel, Fachwerk, Bauhaus, Görlitz, Postkartenästhetik. Und vieles antwortet mir direkt, nein, geh’ weiter, es ist nicht schön hier und es wird auch nicht schön werden, wenn die Sonne scheint und die Bäume blühen. Braungraue Landstriche im deutschen Frühjahr, recht viel Ödnis, wenig Spektakuläres. Dann erscheinen wieder Orte, die erschlagend formvollendet saniert und dabei dennoch leer an Leben sind, klinisch reine und sterile Museumsschönheit: Bitte nichts berühren, bitte alles ordentlich halten, wir haben uns so viel Mühe dabei gegeben es herauszuputzen.
Und dann steige ich in Bad Schandau aus, nehme die S-Bahn zurück nach Königstein, baue mein Zelt zwischen der Elbe und den hochfrequentierten, tschechisch-deutschen Nadelöhrgleisen auf, schaue auf den Lilienstein direkt vor mir, die Festung direkt hinter mir, gehe los und höre drei Tage nicht mehr auf in Schönheit zu wandeln und zu wandern. Ich springe durch das phantastische Wegenetz, ohne Karte, ohne Plan und vor allem ohne Gepäck. Verglichen mit dem Rucksackmarsch ist dies hier ein kleiner Sprint, hoch die Berge, runter die Hügel, jetzt noch bis Pirna? Warum denn nicht? Morgen auf die Bastei, na klar. Es ist Urlaub für die Augen, für die Seele, für den Körper. Einkehrmöglichkeiten, Pommes, Brezeln, frisch Gezapftes, Wasserfälle, die angestaute Extraportionen Wasser laufen lassen und „Conquest of Paradise“ spielen, wenn man fünfzig Cent zahlt. Hier erwerbe ich meine ersten Wandernadeln für den Spazierstock.
Es ist vermutlich der schönste Fleck, den ich bisher in Deutschland gesehen habe, meine Seele hängt durch, baumelt in diesen lichten Wäldern zwischen Affenfelsen und Raddampferflotte. Das Motto des Campingplatzes auf dem ich drei Tage übernachte ist ein altes Zitat von Goethe: „Man reist nicht um anzukommen sondern um zu reisen.“ Da hat er etwas wunderschönes gesagt, ich möchte ihn Herzen nach all diesen Nicht-Orten, den verrammelten Bahnhofshallen, den verwaisten Restaurantterrassen, den menschenfeindlichen Malls, vor denen ich immer weiter weg reisen möchte. Das Glück auf Erden liegt auf den Wegen, Straßen und Schienen, dort vergesse ich den „establishment blues“, die Vision eingebildeter und gnadenlos überschätzter Erster-Welt-Probleme.
–
Die sich immer wieder kreuzenden Wege und Pfade sind  wundervoll geeignet um sich treiben zu lassen, planlos von einem Ausblick zum nächsten zu gelangen, immer wieder überrascht zu werden. Sachsen, du kannst so wunderschön sein. Ich verlangsame mein Tempo und laufe einige hundert Meter mit einem alten Herrn aus Hannover bei entspanntem Plausch über die Deutsche Bahn und die Sächsische Schweiz. Es wird ihm unangenehm, dass er mich durch seinen langsamen Schritt ausbremst und somit schickt er mich weiter. An der Festung treffen wir uns wieder und er setzt sich zu mir an einen Tisch des Biergartens. Seiner Begleitung ist dies zunächst sehr unangenehm, nur mit einiger beschwichtigender Überredungskunst gesellt er sich schließlich ebenfalls zu uns. Wir unterhalten uns eine gute Stunde über Deutschland. Beide sind Rentner und derzeit recht besorgt – wegen den Demonstrationen, wegen brennenden Flüchtlingsheimen, Sachsen, das wollten sie sich auch mal ansehen. Dann machen sie sich Sorgen um mich, ob ich keine Angst habe ganz alleine, ob ich wirklich am Montag nach Dresden möchte, man sehe mir doch meine Gesinnung zweifelsfrei an. Welche Gesinnung möchte ich wissen und sie sagen, naja, zumindest eine andere Gesinnung als die der braunen Suppe. Wir verstehen uns und das freut mich sehr, denn der zweite von ihnen hat mich anfangs sehr abschätzend angesehen, er hat die Nase gerümpft und nun, am Ende der Unterhaltung schüttelt er mir kräftig und motivierend die Hand, wünscht mir viel Glück und alles Gute.
wundervoll geeignet um sich treiben zu lassen, planlos von einem Ausblick zum nächsten zu gelangen, immer wieder überrascht zu werden. Sachsen, du kannst so wunderschön sein. Ich verlangsame mein Tempo und laufe einige hundert Meter mit einem alten Herrn aus Hannover bei entspanntem Plausch über die Deutsche Bahn und die Sächsische Schweiz. Es wird ihm unangenehm, dass er mich durch seinen langsamen Schritt ausbremst und somit schickt er mich weiter. An der Festung treffen wir uns wieder und er setzt sich zu mir an einen Tisch des Biergartens. Seiner Begleitung ist dies zunächst sehr unangenehm, nur mit einiger beschwichtigender Überredungskunst gesellt er sich schließlich ebenfalls zu uns. Wir unterhalten uns eine gute Stunde über Deutschland. Beide sind Rentner und derzeit recht besorgt – wegen den Demonstrationen, wegen brennenden Flüchtlingsheimen, Sachsen, das wollten sie sich auch mal ansehen. Dann machen sie sich Sorgen um mich, ob ich keine Angst habe ganz alleine, ob ich wirklich am Montag nach Dresden möchte, man sehe mir doch meine Gesinnung zweifelsfrei an. Welche Gesinnung möchte ich wissen und sie sagen, naja, zumindest eine andere Gesinnung als die der braunen Suppe. Wir verstehen uns und das freut mich sehr, denn der zweite von ihnen hat mich anfangs sehr abschätzend angesehen, er hat die Nase gerümpft und nun, am Ende der Unterhaltung schüttelt er mir kräftig und motivierend die Hand, wünscht mir viel Glück und alles Gute.
Drei Tage benötige ich hier keinen MP3-Player, keine Telefonate und Kurzmitteilungen, ich bin hier eins mit allem, falle jeden Abend komplett erschlagen und wundervoll erschöpft in mein Zelt, und lasse mich auch durch den nächtlichen Frost nicht von meiner Nachtruhe abhalten. Ich bin dermaßen in diesem Lauf und diesem Gebirge gefangen, dass ich den fünfhundertsten Geburtstag des Reinheitsgebots, den ich gerne auf einem Volksfest oder in einem Biergarten verbracht hätte, vollkommen vergesse. Ich verbringe ihn munter wandernd zwischen unendlichen Aneinanderreihungen quietschebunter Funktionskleidung und Abends in der Saunalandschaft der Toskana-Therme.
–
 Am nächsten Morgen, dem Sonntag werde ich früh von quälender Schlagermusik geweckt, ununterbrochene Laufgeräusche direkt neben meinem Zelt, direkt neben meinem Kopf. Ich schäle mich aus Schlafsack und Zelt und befinde mich mitten in der Einlaufphase eines Marathons. Schwarze Leggins, pinke Leggins, Schweißbänder, Sonnenbrillen, beißender Wind. Schnell anziehen und weg hier ist mein Impuls. Immer wieder diese Schlagermusik, es ist eine Zumutung in dieser Lautstärke, in dieser Kälte, auf nüchternen Magen. Mehr laufend als gehend mache ich mich auf in Richtung Rathen, wo ich nach der Überfahrt mit der Fähre eine Wandernadel in Form eines Zwölfenders erwerbe. Sie ist an Kitsch nicht zu übertreffen und ich muss sie einfach haben.
Am nächsten Morgen, dem Sonntag werde ich früh von quälender Schlagermusik geweckt, ununterbrochene Laufgeräusche direkt neben meinem Zelt, direkt neben meinem Kopf. Ich schäle mich aus Schlafsack und Zelt und befinde mich mitten in der Einlaufphase eines Marathons. Schwarze Leggins, pinke Leggins, Schweißbänder, Sonnenbrillen, beißender Wind. Schnell anziehen und weg hier ist mein Impuls. Immer wieder diese Schlagermusik, es ist eine Zumutung in dieser Lautstärke, in dieser Kälte, auf nüchternen Magen. Mehr laufend als gehend mache ich mich auf in Richtung Rathen, wo ich nach der Überfahrt mit der Fähre eine Wandernadel in Form eines Zwölfenders erwerbe. Sie ist an Kitsch nicht zu übertreffen und ich muss sie einfach haben.
Die Bedeutung der Bastei in Rathen wird daran gemessen, dass sie einmal als Bildschirmschonermotiv für Windows genutzt wurde. Sie ist aber auch wirklich spektakulär. Hier treffe ich dann endlich wieder einige Girls. Eine Rentnergruppe Frauen aus der Rhön spaziert eine Weile mit mir, heftiges Geflirte. Ganz alleine sei ich im Zelt, ohne jemanden zum Anschmiegen und Wärmen, sie würden sich da anbieten. Ich muss sie in den Arm nehmen und drücken. Dann beginnt es zu hageln und unsere Wege verlaufen sich im Restaurant auf der Bastei.
Dort werde ich Zeuge wie eine deutsche Frau einer syrischen Frau am Nebentisch das geteilte Kapitel unserer deutschen Geschichte näher bringt. Die Entstehung zweier separater Staaten, die friedliche Revolution, das langsame Zusammenwachsen. Sie spricht auch über den deutschen Pazifismus, wie wir schmerzhaft begriffen haben, dass wir die Welt in Flammen gelegt haben und man später auf uns aufgepasst hat, weil man es musste und nicht wollte, dass wir zum dritten mal einen Krieg beginnen. Sie spricht vom Glück, das wir hatten und das auch dafür gesorgt hat, dass wir heute keinen Krieg mehr möchten, weder verursachen, noch mitkämpfen. Typisch deutsch, sagt sie und die syrische Frau nickt, bestätigend, anerkennend. Sie trinken ihren Tee, sprechen über die Mentalität des syrischen Mannes und erklären sich gegenseitig ihre Lebenswelten. Der Gast wird an die Hand genommen, an einen herrlichen Ort geführt, auf einen Tee eingeladen und mit hiesigen Werten, Einstellungen, Marotten vertraut gemacht. Es ist gelebte Willkommenskultur, Gastfreundschaft, Offenheit. Ich bin gerührt und beruhigt, ich spüre, dass ich mir diese Szene in den kommenden Tagen oft in Erinnerung rufen werden muss um nicht zu verzagen.
–
Auf der sonnigen Terrasse einer Destillerie direkt an der  Elbe setzt sich eine Frau einige Stunden später an den Nebentisch, sie grüßt freundlich, ich grüße freundlich. Kurze Zeit später kommt ihr Mann hinzu, er schaut mich an, ich schaue ihn an und nicke. Er reagiert mit stummen Abwenden und nimmt neben seiner Frau Platz. Vom ersten Moment an vergiftet er die herrlich-stille und friedliche Atmosphäre auf der Terrasse. Auf der anderen Elbseite sehe ich die Ausläufer des Marathons, hier nun ein verbaler Nörgelmarathon. Er will sich nicht mit den oberflächlichen Bekannten treffen. Er mag deren Neid nicht. Er mag auch die Sauna nicht. Er mag die Pollen nicht und auch das Wetter nicht. Seine Tonlage ist eine Zumutung, dieser Mensch funktioniert vollends ohne Lächeln, ohne „Bitte“, „Danke“, „Entschuldigung“. Auch seiner Frau reicht es irgendwann, „ich habe es satt, dass es immer nur um dich geht!“ Er will den Kuchen nicht, den sie bestellt hat. Als sie dann für einige Minuten die Toilette aufsucht und er den Kuchen serviert bekommt, isst er ihn vollends alleine auf, bevor sie zurück am Tisch ist. Während er über die größte Raddampferflotte spricht – „überleg’ dir das mal! Hier in Sachsen! Da muss man stolz drauf sein!“ – wird mein Flammkuchen serviert. Sie hat den gleichen bestellt, weshalb beide auf meinen Teller gaffen. Und während ich noch überlege, ob ich dieser hellen Frau mit ihrem dunklen Gatten etwas anbiete, als Antwort auf ihr gegrinstes „na dann lassen sie es sich schmecken!“, stürmt er als verbale sächsische Raddampferflotte in meinen Gedanken; „na, jetzt kannste ihr aber auch ein Stück abgeben und sie revanchiert sich dann später!“ Sie wehrt natürlich sofort ab und mir bleibt nun nichts mehr außer der Konfrontation. „Für sie oder für ihre Frau?“ „Nää, ich mag sowas nicht!“ „Sie mochten auch den Kuchen nicht.“ Ab dem Moment ist erst einmal Ruhe zwischen uns. Was erwartet er auch? Natürlich ist es unhöflich andere Menschen zu belauschen. Es ist aber auch unhöflich, den eigenen Menschenhass durch Restaurants zu krakeelen. Ein Hund bellt entfernt und er ruft tatsächlich über die Terrasse „Halt die Fresse!“ Ich muss mitleidig lachen und den Kopf derart theatralisch schütteln, dass er bemerkt wie wenig ich für ihn übrig habe an Achtung, Respekt und Wertschätzung. Sie schämt sich für ihn, blickt mich entschuldigend an und ich denke, wie kannst du nur leben an so einer Seite? Ich trinke meinen Bio-Ingwer-Geist und gehe weiter, weiter, immer weiter.
Elbe setzt sich eine Frau einige Stunden später an den Nebentisch, sie grüßt freundlich, ich grüße freundlich. Kurze Zeit später kommt ihr Mann hinzu, er schaut mich an, ich schaue ihn an und nicke. Er reagiert mit stummen Abwenden und nimmt neben seiner Frau Platz. Vom ersten Moment an vergiftet er die herrlich-stille und friedliche Atmosphäre auf der Terrasse. Auf der anderen Elbseite sehe ich die Ausläufer des Marathons, hier nun ein verbaler Nörgelmarathon. Er will sich nicht mit den oberflächlichen Bekannten treffen. Er mag deren Neid nicht. Er mag auch die Sauna nicht. Er mag die Pollen nicht und auch das Wetter nicht. Seine Tonlage ist eine Zumutung, dieser Mensch funktioniert vollends ohne Lächeln, ohne „Bitte“, „Danke“, „Entschuldigung“. Auch seiner Frau reicht es irgendwann, „ich habe es satt, dass es immer nur um dich geht!“ Er will den Kuchen nicht, den sie bestellt hat. Als sie dann für einige Minuten die Toilette aufsucht und er den Kuchen serviert bekommt, isst er ihn vollends alleine auf, bevor sie zurück am Tisch ist. Während er über die größte Raddampferflotte spricht – „überleg’ dir das mal! Hier in Sachsen! Da muss man stolz drauf sein!“ – wird mein Flammkuchen serviert. Sie hat den gleichen bestellt, weshalb beide auf meinen Teller gaffen. Und während ich noch überlege, ob ich dieser hellen Frau mit ihrem dunklen Gatten etwas anbiete, als Antwort auf ihr gegrinstes „na dann lassen sie es sich schmecken!“, stürmt er als verbale sächsische Raddampferflotte in meinen Gedanken; „na, jetzt kannste ihr aber auch ein Stück abgeben und sie revanchiert sich dann später!“ Sie wehrt natürlich sofort ab und mir bleibt nun nichts mehr außer der Konfrontation. „Für sie oder für ihre Frau?“ „Nää, ich mag sowas nicht!“ „Sie mochten auch den Kuchen nicht.“ Ab dem Moment ist erst einmal Ruhe zwischen uns. Was erwartet er auch? Natürlich ist es unhöflich andere Menschen zu belauschen. Es ist aber auch unhöflich, den eigenen Menschenhass durch Restaurants zu krakeelen. Ein Hund bellt entfernt und er ruft tatsächlich über die Terrasse „Halt die Fresse!“ Ich muss mitleidig lachen und den Kopf derart theatralisch schütteln, dass er bemerkt wie wenig ich für ihn übrig habe an Achtung, Respekt und Wertschätzung. Sie schämt sich für ihn, blickt mich entschuldigend an und ich denke, wie kannst du nur leben an so einer Seite? Ich trinke meinen Bio-Ingwer-Geist und gehe weiter, weiter, immer weiter.
In Pirna verbringe ich den Abend in einem Irish-Pub, immer wieder zieht es mich in diese Kneipen, für die ich sonst sehr wenig übrig habe. Immer sind sie belebt und in jeder noch so kleinen Provinzstadt ab zehntausend Einwohnern findet man so einen stockdunklen Pub. Ich trinke Bier und Whiskey und lausche der Herrengruppe hinter mir, zotige Sprüche über Frauen, an sich und die eigenen, über Arbeit, an sich und die eigene und über die Mitglieder der Gruppe, die heute nicht hier sind. Jedes mal wenn ich mir über meinen Alkoholkonsum während dieser Wanderung Gedanken mache – kein Tag vergeht ohne Bier – treffe ich auf eine solche Gruppe, die ihre Biere wegatmet, eine Runde Schnaps nach der nächsten bestellt, mich sehr brav aussehen lässt mit meinen eins, zwei Bierchen. Als wollten sie mir Mut zusprechen, sorge Dich nicht, trink’ noch eins!
Hier in Pirna allerdings auch zu sehen: Sehr kräftige Halbstarke, Stiernacken mit szenetypischen Haarschnitten, Männer um deren Toleranzelastizität es nicht sehr weit her scheint, was wiederum zu mangelnder Toleranz meinerseits führt: Ich möchte ihnen meine Abscheu gerne ins Gesicht schreien können – traue mich aber nicht. Es sind menschliche Bullterrier, die mir hier begegnen und sie starren mich an wie die Katze vom Nachbarn. Ich kann bloß: Auf die Straße spucken. Einen bösen Blick aufsetzen. Hoffen, dass ihnen dies nicht zu viel der Provokation ist. Es passiert nichts, hingegen der Vermutung meiner Freunde bekomme ich nicht „auf’s Maul“.
Heidenau, Dresden, Pegida, dies alles liegt jedoch noch vor mir und es wird irgendwie dunkler.
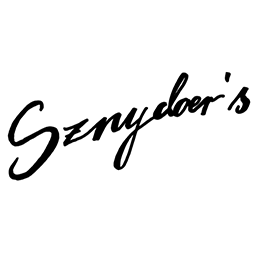



Leave a Reply