BAUTZEN – DRESDEN – LEIPZIG – LUTHERSTADT WITTENBERG
–
Es kommen die Tage, an denen ich meinen Umweg nehmen muss.
Meine Berliner Wohngemeinschaft benötigt mal wieder einen neuen Mitbewohner und ich muss natürlich bei dem unvermeidlichen Auswahlcasting vor Ort sein. Ich habe weder Lust auf diese Notwendigkeit, noch auf Berlin an sich, denn ich bin nun einerseits gewöhnt an das Laufen im Ländlichen und habe zudem etwas Respekt vor all den städtischen Reizen und Versuchungen – weil ich sie hier draußen natürlich vermisse. Entsprechend unmotiviert und schwerfällig verlasse ich früh morgens die Bautzener Jugendherberge nach einem typischen Jugendherbergsfrühstück in Richtung des Bahnhofs. Dieser ist ein modernes Mahnmal: Die Substanz des Gebäudes ist wunderschön, der unbeleuchtete Bau allerdings verschlossen, massive Ketten sind um die Türen gespannt, sämtliche Fenster mit Holzbrettern zugenagelt. Ein kleines Schild verweist auf den Hintereingang, der so winzig ist, dass ich zweimal an ihm vorbeilaufe bis ich die kleine Tür finde. Drinnen wird man von rot-weißem Absperrband und entlang an vollgeschmierten und provisorischen Holzwänden in einen düsteren Winkel der verwaisten Halle geleitet. Dort finde ich einen kleinen Schalter, an dem eine Dame die Fahrgäste bedient, ein Fahrkartenautomat ist nicht vorhanden. Draußen dann neben den Gleisen steht das riesige Plakat einer großen Baumarktkette. Darauf liest sich deren neuer Werbeslogan: „Du lebst. Erinnerst du dich?“
Überhaupt: Bautzen. Am Nachmittag zuvor bin ich hier angekommen, nach einem sehr frühen Aufbruch vom Ferienhof in Buchholz und einer zweiten Tagestour auf dem Ökumenischen Jakobsweg. Wunderschön und idyllisch scheint die Stadt und etwas dem Verfall und Abzug preisgegeben, wie es oft der Fall ist mit den mittelgroßen Städten. Das Modegeschäft „Timo-Out“ macht seinen Namen zum Programm, sogar die Schrift vom „Zu Verkaufen“- Schild bleicht langsam aus. Gemahnmale überall, 1914-1918, 1939-1945, für die Opfer der Sowjets selbstverständlich.
Auf dem Kornmarkt – diesem mittlerweile zu zweifelhafter Berühmtheit gelangten Platz – treffe ich auf einen Skateboarder, den ersten während der Wanderung. Einsam und souverän rollt er seine Runden und zerhackt die Stille mit seiner Ahornplanke und den Polyurethanrollen, Klack-Klack, Schaller-Schaller. Ansonsten: Keine Jugend zu sehen, keine Bar zu finden. Dafür Autos mit „Wild Wild East“ – Aufklebern und ein dazu passendes Döner-Restaurant: Es handelt sich wohl um ein ehemaliges Westernrestaurant und ist viel zu groß für die Handvoll Gäste, die sich die handgemachten Dürüms schmecken lassen. Über zwei Stockwerke breitet sich dieser Zeitreiseort aus, bietet dabei Platz für zweihundert potentielle Gäste. Longhorn-Hörner an der Wand, Lassos, Zigarettenwerbungen, alle Details präsentieren sich hier im Cowboystil und irgendwie macht es mir Lust auf Baklava, Weinblätter, Hummus und alles weitere, was nichts mit dem Westen zu tun hat.
Ich überlege später, auch zum Abendessen anatolisch zu speisen, doch ich ende erneut in einem deutschen Gasthaus. Die Bedienung trägt eine sorbische Tracht, dazu dunkles Holz wohin man schaut, Geweihe, Hellebarden, Pistolen, Stickereien an den Wänden, Andrea Berg aus der Musikanlage. Ein sehr junges Pärchen sitzt beim romantischen Abendessen in einer dunklen Ecke. Auch hier verspeise ich die Tellergarnitur inklusive dem letzten Petersilienstängel mit, ich genieße die Blicke auf mich als kleinen Mann mit unvorstellbarem, unstillbarem Hunger. Wie immer gebe ich sehr gut Trinkgeld, bin ein strahlender, zufriedener, lächelnder Gast. Wie immer bekomme ich keinen Schnaps angeboten. Die Geste an sich wäre etwas tolles, für einen guten Gast wäre dies die Antwort eines guten Gastwirts. Sie bleibt mir vergönnt, vollends.
Und dann geht es in aller Frühe von der wunderbaren Jugendherberge zum Bahnhof. Das Mitbewohnercasting findet sehr sicher – aber eben noch nicht zu einhundert Prozent sicher – am nächsten Tag statt und somit will ich mir die Möglichkeit offen halten, wieder umzukehren sofern es sich meine WG doch noch anders überlegt als zunächst geplant. Ich buche also die Städtetour von Bautzen über Dresden nach Leipzig und schließlich Lutherstadt-Wittenberg, wo ich heute übernachten möchte.
–
 Im ersten Zug nach Dresden betritt dann eine sehr alte, drahtige Frau den Zug. Sie eilt direkt mit ihrer Fahrkarte zur Kontrolleurin, die sie darauf hinweist, dass diese nicht abgestempelt wurde. Sie möchte keine Strafgebühr verlangen, keine neue Fahrkarte, keine schriftliche Mahnung aussprechen – sie unternimmt nichts strafendes und ist damit der Inbegriff der Kulanz. Doch die alte Frau ist außer sich und hat ein Problem mit der Maßregelung durch jemand anderen. Erbost den Kopf schüttelnd nimmt sie neben mir Platz. Ich bekomme gerade eine akustische Udo-Lindenberg-Kur, die mich aus der Bautzener Bahnhofs- niedergeschlagenheit heraus holen soll. Die Frau neben mir flucht und schimpft ohne Unterlass in diesem verheult klingenden sächsischen Sing-Sang. „Eine Frechheit“ höre ich, „Ich fahre so oft nach Dresden!“, „muss die mich so anmotzen“, „treue Kundin“ undsoweiterundsofort. Ihr Kopf zuckt erregt von links nach rechts, sie schnaubt. Nach etwa fünf Minuten nehme ich meinen Kopfhörer aus dem Ohr und schaue sie an. „Entschuldigen sie, sprechen sie eigentlich mir mir?“ frage ich. „Nein, nein, ich meine ja nur, wie unfreundlich die zu mir war…“ und ich muss mich wirklich bremsen, ihr nicht zu erklären, dass ihr eben genau genommen geholfen wurde. Dass der eigentliche Job der Kontrolleurin, nämlich sie zu kontrollieren und bei einem Fehlverhalten ein Bußgeld zu verlangen, zu ihren Gunsten vernachlässigt wurde. Dass sie jetzt, wenn schon nicht dankbar, verdammt noch mal, zumindest still sein soll! Ich bremse mich durch demons- tratives im-Satz-stehen lassen, schaue auf der anderen Seite aus dem Fenster und lausche der Geschichte von Gerhard Gösebrecht. Sie hingegen flucht weiter.
Im ersten Zug nach Dresden betritt dann eine sehr alte, drahtige Frau den Zug. Sie eilt direkt mit ihrer Fahrkarte zur Kontrolleurin, die sie darauf hinweist, dass diese nicht abgestempelt wurde. Sie möchte keine Strafgebühr verlangen, keine neue Fahrkarte, keine schriftliche Mahnung aussprechen – sie unternimmt nichts strafendes und ist damit der Inbegriff der Kulanz. Doch die alte Frau ist außer sich und hat ein Problem mit der Maßregelung durch jemand anderen. Erbost den Kopf schüttelnd nimmt sie neben mir Platz. Ich bekomme gerade eine akustische Udo-Lindenberg-Kur, die mich aus der Bautzener Bahnhofs- niedergeschlagenheit heraus holen soll. Die Frau neben mir flucht und schimpft ohne Unterlass in diesem verheult klingenden sächsischen Sing-Sang. „Eine Frechheit“ höre ich, „Ich fahre so oft nach Dresden!“, „muss die mich so anmotzen“, „treue Kundin“ undsoweiterundsofort. Ihr Kopf zuckt erregt von links nach rechts, sie schnaubt. Nach etwa fünf Minuten nehme ich meinen Kopfhörer aus dem Ohr und schaue sie an. „Entschuldigen sie, sprechen sie eigentlich mir mir?“ frage ich. „Nein, nein, ich meine ja nur, wie unfreundlich die zu mir war…“ und ich muss mich wirklich bremsen, ihr nicht zu erklären, dass ihr eben genau genommen geholfen wurde. Dass der eigentliche Job der Kontrolleurin, nämlich sie zu kontrollieren und bei einem Fehlverhalten ein Bußgeld zu verlangen, zu ihren Gunsten vernachlässigt wurde. Dass sie jetzt, wenn schon nicht dankbar, verdammt noch mal, zumindest still sein soll! Ich bremse mich durch demons- tratives im-Satz-stehen lassen, schaue auf der anderen Seite aus dem Fenster und lausche der Geschichte von Gerhard Gösebrecht. Sie hingegen flucht weiter.
–
In Dresden am Hauptbahnhof, wo ich eine Stunde mit Gesichterschauen verbringe, sehe ich viele unglücklich geneigte Mundwinkel. Der Umgang färbt ab, meine Laune wird hier nicht besser. Spurlos geht dieser Morgen – der Bautzener Bahnhof, Dresden und scheinbar auch die Alte aus dem Zug zuvor – nicht an mir vorbei und so liefere ich mir ein kleines Wortgefecht mit der Kontrolleurin im Zug nach Leipzig: Meine bereits gestempelte Karte möchte sie nun nochmals kontrollieren und benötigt hierfür unbedingt einen Lichtbildausweis. Nirgendwo auf meiner Fahrkarte steht etwas davon, Identifikationsmerkmal ist meine Bahncard und da ich Lust zu streiten bekommen habe, mache ich sie darauf aufmerksam und sehe nicht ein, ihr einen Lichtbildausweis zu zeigen. Sie begründet ihren Wunsch damit, dass meine Bahncard bald ablaufe und als ich wissen möchte, was dies damit zu tun habe sagt sie die wundervoll deutschen Worte „zur Kontrolle“. Aber die Karte sei bereits im vorangegangenen Zug kontrolliert und ordnungsgemäß gestempelt wurden, entgegne ich, auch ohne Lichtbildausweis. Und sie sagt auf ihre spaßfreie Art, mit einem zähneknirschenden Lächeln aus Beton „sicher ist sicher.“ „Nein“ sage ich und ansonsten nichts weiter, und plötzlich ist dann doch alles in Ordnung für sie. Sie muss den Lichtbildausweis weder zur Kontrolle noch zur Sicherheit sehen und lässt mich und meine Sturheit dieses erste verbale, sächsische Scharmützel gewinnen.
In Leipzig vor dem Hauptbahnhof rauche ich eine Zigarette mit einer Gruppe Punks. „Wandersmann, komm’ her!“ rufen sie. Ich werde nicht angeschnorrt, biete aber Tabak an. Zwei Polizeibeamte erscheinen und maßregeln alle in der Gruppe außer mich. Ich werde nicht direkt angesprochen, trotz Bart, Geruch und Gepäck hebe ich mich wohl noch zu sehr von den Punks ab. Der Bahnhof ist hier eine eigene kleine Stadt mit Bäckern, Schreibwarenläden, Elektronikfachhandel, patrouillierenden Polizisten mit Maschinenpistolen im Anschlag, geschäftigem Treiben. Eine Mall in einem Bahnhof: Es ist der vollkommene Nicht-Ort und somit befinde ich mich mental auch nicht in dieser Stadt sondern frage mich bereits, wie Lutherstadt-Wittenberg wohl sein wird.
Nun also Sachsen-Anhalt. Bis zu dieser Landesgrenze: Ein bitterer Tag. Grauer Himmel, Wind, Freudlosigkeit. In LuWi dann blauer Himmel, Sonnenschein, lächelnde Menschen. Tagesform? Lage? Es ist nicht wie eine andere Stadt, es ist wie eine andere Welt. Viel mehr als die zwei, drei Gesten eines geschenkten Lächelns, einer Bahnangestellten, eines Passanten benötigt es nicht und ich umarme mich mit der Willkommenskultur eines Ortes.
Der ewig-lange Fußweg zum Campingplatz, vorbei an einem sehr lauten und stark frequentierten Autobahnzubringer und über eine sehr windige Elbbrücke, verheißt erst einmal wenig Gutes. Dort baue ich schnell mein Zelt auf und verschwinde rasch wieder in die Stadt auf der anderen Flussseite. Dort sehe ich unmittelbar nacheinander zwei sehr schöne junge Frauen, ich grüße beide und beide grüßen zurück, die eine lächelnd, die andere gar strahlend. Mein Herz geht auf. Augenblicklich bin ich versöhnt mit der Reise in diesen Ort, die mir heute morgen noch wie der größtmögliche Umweg und eine gigantische Schikane vorkam.
Japanische Touristengruppen bevölkern den Marktplatz, eine kleine Eisenbahn dreht ihre Runden durch den historischen Altstadtkern, Menschen bevölkern die Terrassen und Außenbereiche, in die Sonne blinzelnd, in Gespräche vertieft. Antiquitätenläden, Eiskaffees. Luther, freilich: überall. Die gesamte Stadt lächelt mich an und ich lächle zurück. Ist es das Wetter? Ist es Sachsen-Anhalt? Jeder Passant hier scheint beseelt von einer merkwürdigen Zuversicht, die Sachsen wiederum in den vergangenen Tagen vollkommen gefehlt hat. Egal ob es der verschrobene Rahmenhändler ist, die Bedienung im Eiscafé, die Touristen für die ich ein Foto schieße, wie sie vor dem Lutherhaus posieren: Alle strahlen etwas zutiefst optimistisch-freundliches aus.
–
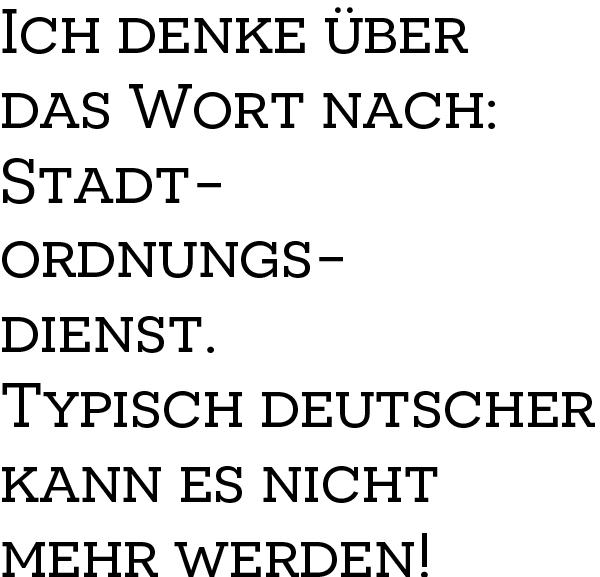 Ich suche einen sonnigen Ort mit Ausschankgenehmigung und muss lange laufen bis ich ein Wirtshaus am Ende der Fußgängerzone finde. Die Tische im Außenbereich liegen in der besten Nachmittagssonne, ich setze mich und mache einige Notizen. Nach einer unbedienten Viertelstunde gehe ich hinein zum Bestellen und sehe folgendes: Ein Raum aus Rauch, abgedunkelt, schummrig, zwanzig Gäste sitzen dort, alle ebenfalls abgedunkelt und schummrig. Es herrscht ein Licht und eine Stimmung wie in dem bekannten, entrückend schönen Foto, dass Angela Merkel bei dem Besuch in einer Fischerhütte in ihrem Wahlkreis zeigt, aufgenommen von Michael Ebner 1990 während Merkels erstem gesamtdeutschen Wahlkampf. Man kann den Tabakrauch in diesem Foto riechen und die Gesichter der Fischer sagen alles, was gesagt werden müsste. Hier nun der gleiche Rauch, die gleichen zwei schneidenden Lichtkegel, die vom Fenster her dem Qualm seinen üppigen Körper geben, den Raum mit ihm sichtbar ausfüllen, blau und grau wabernd, dazu ähnliche Gesichter wie auf dem Foto, in die ich hier blicke. Die eine Hälfte von ihnen ist in ihre bierseligen Gespräche vertieft, die andere Hälfte starrt mich aus glasigen Augen heraus an. „Wannersmännchen“ murmelt einer, eine andere hebt ihr Glas zur Begrüßung in meine Richtung, ihre Augen versuchen mich zu fixieren. Ich bestelle mein Pils für draußen und als die Bedienung es mir serviert frage ich sie “Da seid ihr der einzige Ort in der Stadt wo man in der Sonne ein Pils trinken kann und dann sitzen alle drinnen im Dunkeln. Was ist denn da los?“ „Ja“ sagt sie und grinst „die vertragen die frische Luft nicht so gut. Das sind aber auch die ganz hart gesottenen, für die ist es auch besser wenn sie drinnen bleiben.“ Sicher, für sie ist es besser wenn sie drinnen sind, wo sie niemand sehen kann in ihrem nachmittäglichem Suff. Für diese Gastronomie ist es sicher auch besser, denn Gäste nehmen nun draußen Platz ohne von der Seite angenuschelt zu werden, ohne die zotigen Sprüche zu hören und die hochroten, aufgedunsenen Gesichter anschauen zu müssen. Und für die Stadt ist es sicherlich auch von Vorteil, wenn die japanischen und amerikanischen Touristengruppen, die in der Bimmelbahn an der Kneipe vorbeifahren, nicht in diese glasigen Tortelliniaugen sehen müssen. Aber für dich, liebes Deutschland, wäre es sehr gut, wenn wieder etwas mehr Leben auf der Straße und nicht hinter den schweren Türen stattfinden würde.
Ich suche einen sonnigen Ort mit Ausschankgenehmigung und muss lange laufen bis ich ein Wirtshaus am Ende der Fußgängerzone finde. Die Tische im Außenbereich liegen in der besten Nachmittagssonne, ich setze mich und mache einige Notizen. Nach einer unbedienten Viertelstunde gehe ich hinein zum Bestellen und sehe folgendes: Ein Raum aus Rauch, abgedunkelt, schummrig, zwanzig Gäste sitzen dort, alle ebenfalls abgedunkelt und schummrig. Es herrscht ein Licht und eine Stimmung wie in dem bekannten, entrückend schönen Foto, dass Angela Merkel bei dem Besuch in einer Fischerhütte in ihrem Wahlkreis zeigt, aufgenommen von Michael Ebner 1990 während Merkels erstem gesamtdeutschen Wahlkampf. Man kann den Tabakrauch in diesem Foto riechen und die Gesichter der Fischer sagen alles, was gesagt werden müsste. Hier nun der gleiche Rauch, die gleichen zwei schneidenden Lichtkegel, die vom Fenster her dem Qualm seinen üppigen Körper geben, den Raum mit ihm sichtbar ausfüllen, blau und grau wabernd, dazu ähnliche Gesichter wie auf dem Foto, in die ich hier blicke. Die eine Hälfte von ihnen ist in ihre bierseligen Gespräche vertieft, die andere Hälfte starrt mich aus glasigen Augen heraus an. „Wannersmännchen“ murmelt einer, eine andere hebt ihr Glas zur Begrüßung in meine Richtung, ihre Augen versuchen mich zu fixieren. Ich bestelle mein Pils für draußen und als die Bedienung es mir serviert frage ich sie “Da seid ihr der einzige Ort in der Stadt wo man in der Sonne ein Pils trinken kann und dann sitzen alle drinnen im Dunkeln. Was ist denn da los?“ „Ja“ sagt sie und grinst „die vertragen die frische Luft nicht so gut. Das sind aber auch die ganz hart gesottenen, für die ist es auch besser wenn sie drinnen bleiben.“ Sicher, für sie ist es besser wenn sie drinnen sind, wo sie niemand sehen kann in ihrem nachmittäglichem Suff. Für diese Gastronomie ist es sicher auch besser, denn Gäste nehmen nun draußen Platz ohne von der Seite angenuschelt zu werden, ohne die zotigen Sprüche zu hören und die hochroten, aufgedunsenen Gesichter anschauen zu müssen. Und für die Stadt ist es sicherlich auch von Vorteil, wenn die japanischen und amerikanischen Touristengruppen, die in der Bimmelbahn an der Kneipe vorbeifahren, nicht in diese glasigen Tortelliniaugen sehen müssen. Aber für dich, liebes Deutschland, wäre es sehr gut, wenn wieder etwas mehr Leben auf der Straße und nicht hinter den schweren Türen stattfinden würde.
Und während ich die wärmenden Sonnenstrahlen und ein kühles Bier genieße, läuft der Stadtordnungsdienst an mir vorbei. Zwei sehr wohl genährte Beamte watscheln ihre Runde durch das Zentrum und strahlen etwas unverwechselbar Deutsches aus. Eine Stadt kann unmöglich ordentlicher sein, als das Zentrum von Lutherstadt-Wittenberg. Es ist so sauber und aufgeräumt, dass es mein Auge reizt. Ich denke über das Wort nach: Stadtordnungsdienst. Typisch deutscher kann es nicht mehr werden! Es beginnt so verheißungsvoll und abenteuerlich, die Stadt, der wilde Ort in dem vieles, manchmal alles geschehen kann. Doch dann kommt sie, die deutsche Ordnung, sie verspricht Solidität und Aufgeräumtheit in einer flüchtigen und manchmal hektischen Welt. Pläne, Sauberkeit, Pünktlichkeit, alles akkurat, sicher, planmäßig, das ist die Devise. Und dann der Dienst: Die Schicht, die Arbeit, natürlich, ohne Fleiß kein Preis und von Nichts kommt ja bekanntlich bloß noch mehr Nichts. Ich denke an die Protestantische Arbeitsethik, die eine Manifestation in dem Wort „Stadtordnungsdienst“ findet und die hier, in der Lutherstadt Wittenberg wohl sehr ausgeprägt sein wird.
Ich trinke aus und drehe weitere Runden durch die Stadt, finde ein an Hässlichkeit schwer zu übertreffendes Einkaufszentrum, ohne das einem mittelgroßen Ort heute scheinbar seine Daseinsberechtigung abgesprochen wird.
In den Wirtshäusern sind sämtliche Plätze belegt oder reserviert, ein gutes Zeichen für einen Ort: Lutherstadt-Wittenberg, ich freue mich für dich. Ich entscheide mich für einen neumodischen Burgerladen, selbst gemachte Patties, Pastinakenpommes, exotische Saucen und Limonaden; ein unerwarteter Hauch Berliner Gastronomiekultur in dieser Nebenstraße. Es wird der beste Burger meines Lebens sein, den ich hier esse. Ich bin ein zutiefst glücklicher Mensch, als ich das Restaurant verlasse und zum dritten mal über die Elbe laufe.
Auf dem Campingplatz fühle ich mich noch nicht nach Ruhe und entscheide mich, ein weiteres mal zurück in die Stadt zu gehen. Ich finde schnell einen Irish Pub, der das DFB-Pokalspiel des BVB gegen die Hertha überträgt. Am Nebentisch sitzt eine Gruppe junger Leute, die sich ehrenamtlich für Flüchtlinge engagiert und später, etwa ab dem dritten Bier, über Basisarbeit der Partei streitet. Eine schwedische Reisegruppe nimmt draußen Platz und erleuchtet alles durch ihre typisch skandinavische Eleganz und Schönheit. Dortmund gewinnt ungefährdet, glücklich laufe ich zurück zum Platz, erneut über die stürmische Elbe hinweg.
Wieder zurück auf dem Campingplatz dann, ich rauche eine letzte Zigarette auf der Sitzgruppe vor meinem Zelt, beginnt ein Hund zu bellen. Es ist das Keifen eines scharfen Schäferhundes und dringt ohne Unterlass aus der Dunkelheit etwa hundert Meter vor mir. Ich schaue ein paar Minuten in die Richtung, aus der das Bellen die Stille zerhackt und gebe mir Mühe, mich nicht zu bewegen. Gilt das Bellen mir? Ist das womöglich ein Sicherheitsdienst? Was denken die anderen Campinggäste über diesen Krach, schließlich ist es nach elf Uhr in der Nacht? Ich nehme meinen Kulturbeutel und gehe hinüber zum Waschhaus, also direkt in die Richtung des Bellens. Ich entscheide mich für die Geste des „Scheibenwischers“ als ich vor der bellenden Dunkelheit innehalte um einem potentiellen aber unsichtbaren Wachmann klar zu machen: Typ, was soll der Mist?
Die Tür des Waschhauses ist sehr massiv und schwer, sie kriecht die ersten 97 Prozent ihres Weges zurück Richtung Türrahmen und fällt dann mit einem ohrenbetäubenden, campingplatzerschütternden Knall in das Schloss – eine wundervoll sinnlose Konstruktion. Das Knallen der Tür provoziert den Hund in der Dunkelheit und das scharfe, ununterbrochene Bellen setzt sich fort. Mir bleibt nichts übrig, als zurück zu meinem Zelt zu gehen, wo ich noch etwas lausche und dankbar bemerke, wie das Bellen langsam aufhört. Ich lege mich in den Schlafsack und ziehe diesen zu, es wird eine sehr kalte Nacht werden. Ich bin so eng eingeschnürt, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mein Kopf sackt auf das kleine Kissen von AirFrance. Genau in diesem Moment höre ich Schritte, Tapsen neben dem Zelt, direkt neben meinem Ohr. Etwas schnüffelt an meinem Kopf, ich kann mein Herz schlagen hören und bewege mich keinen Millimeter. Das Schnüffeln verstummt und das Tapsen entfernt sich nach endlosen Sekunden. Was war das? Der Hund hätte gebellt und ich hätte ihn zuvor wohl bereits gehört, wie er durch die Wiese schleicht. War es ein Fuchs, der sich in den Büschen neben dem Zelt versteckt hat? Es ist der einzige Moment während der Reise, in dem ich panikartige Angst verspüre. Ich schlafe sehr schlecht in dieser Nacht, es ist bitterkalt und ich erwache mit Frost an meinem Zelteingang und schlechter Laune, weil ich nach Berlin muss.
Durch Berlin haste ich dann im Scheuklappenmodus, kaum ein Blick nach links oder rechts, von Spandau mit der U-Bahn geht es direkt ins bürgerlich-bohème Herz Kreuzbergs. Da gehe ich nun, mit meinem Stock und mit dem Rucksack. Fühlt sich komisch an, fühlt sich erhaben an. Ab nach Hause und nicht nach draußen schauen, zu viele schöne Menschen und Aktivitäten, ich würde es nicht verkraften. Ich versuche in der Laune zu bleiben, die sich nun in mir eingenistet hat, ganz der Eigenbrötler, der Sonderling, die Fliege an der Wand. Es funktioniert einigermaßen, vor allem weil ich bis zum Abend die Wohnung nicht verlasse. Das Casting verläuft dann immerhin erfolgreich, wir können uns auf jemanden einigen und somit sitze ich früh am nächsten Morgen in einem Zugabteil Richtung Sächsischer Schweiz, das ich mir mit mehreren Wanderern teile. Das Elbsandsteingebirge soll nun der Urlaub während meiner Reise sein.
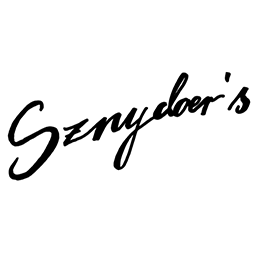



Leave a Reply