…NUR IST DAS SALZ DES VERGNÜGENS.
–
Friedrich Schiller
–
–
OSTDEUTSCHLAND
–
Derweil wird aus den Ausläufern eines bereits milden Winters ein zaghafter Frühling. Winter- werden gegen Sommerreifen gewechselt, Beete angelegt, Rasenflächen gestutzt, Felder bestellt. Die Menschen spannen Fliegengitter vor ihre Türen um ungebetene Gäste draußen zu lassen, damit sie sich nicht auf ihre Torten setzen oder ihre Larven in der Küche verteilen.
–
Veränderung im alltäglichen Verhalten, die Menschen  stellen sich ein auf dieses und jenes, Anpassungen, Adaptionen, typisch zur Jahreszeitenwende, eigentlich alles wie immer. Aber findet hier nicht zur Zeit ein großer gesellschaftlicher Umbruch statt? Auf welchem Stand befindet sich das deutsche Selbstverständnis? Verändert sich etwas Grundlegendes in der Bevölkerung, mit dem Volk? Wer ist das – dieses Volk?
stellen sich ein auf dieses und jenes, Anpassungen, Adaptionen, typisch zur Jahreszeitenwende, eigentlich alles wie immer. Aber findet hier nicht zur Zeit ein großer gesellschaftlicher Umbruch statt? Auf welchem Stand befindet sich das deutsche Selbstverständnis? Verändert sich etwas Grundlegendes in der Bevölkerung, mit dem Volk? Wer ist das – dieses Volk?
Deutschland wandelt sich, hört man. Die größte Veränderung seit der Wende steht bevor, heißt es in „den Medien“, in den O-Tönen der Politiker, in den Einschätzungen von Experten. Von „Zeitenwende“ ist in den Zeitungen die Rede. Umbruch allenthalben.
Eben noch täglich auf zusammengeklebten Nazi-Collagen der wutschnaubenden Südeuropäer verschmäht, heuer plötzlich Sehnsuchtsland der Fliehenden. Hier wird dann doch: Einwanderungsland? Wohin möchtet ihr? „GERMANY!“ sagen so viele mit ebenso leuchtenden wie traumatisierten Augen, an den Grenzen, den Autobahnen, den Auffanglagern. Und wir lassen sie zu uns kommen.
–
Viele Bürger packen unbesorgt, vorbehaltlos und tatkräftig mit an – unerwartet ist das zunächst und dabei eine Genugtuung für jeden, der die Ideen von Europa oder dem Humanismus verinnerlicht hat. Sie bilden klatschende Begrüßungsspaliere, verteilen Essen, definieren das Wort „Willkommenskultur“ und zwar so, dass man sich im Ausland verwundert die Augen reibt: War doch der ernste, kritische, bisweilen jähzornige Deutsche dem Fremden gegenüber stets eher verschlossen, besorgt, mahnend eingestellt. Nun dies: Einladende Gesten, „Wir schaffen das!“, die Vision einer Integration aus der Mitte der Gesellschaft heraus, getragen auf den Schultern vieler Bereit- und Freiwilliger. Wir müssen heute davon ausgehen, dass diese Tage im August 2015 die angeschlagene Ehre Europas zu einem Teil gerettet haben. Denn wie können wir tatenlos dabei zusehen wie Menschen sterben, tagtäglich, auf dem Mittelmeer, in Kühltransportern, auf der Flucht in ein besseres Leben? Ist es nicht die Pflicht, menschlich, gesellschaftlich, hier solidarisch zu sein und zu helfen? Deutschland tut sich zurecht schwer mit dem „Stolz“ – doch während dieser Tage hatte ich persönlich den Eindruck, man könne stolz sein auf dieses Land, und wenn nicht stolz, dann zumindest dankbar.
–
Andere jedoch sahen eben ihren Stolz verletzt in diesen offenen Armen und stecken in der Folge Flüchtlingsheime in Brand, terrorisieren ohnehin traumatisierte Flüchtlinge und beschimpfen Politiker, Medienvertreter, Helfende pauschal als „Vaterlandsverräter.“ Von „Dunkeldeutschland“ ist auf einmal die Rede wenn man über manche Landstriche spricht, und man denkt mit Sorgenfalten zurück an Rostock-Lichtenhagen, an Hoyerswerda oder an noch düsterere Bilder.
Die Silvesternacht wird Deutschland für immer verändern, heißt es dann im Januar. Im März redet kaum noch jemand davon. Mittlerweile macht sich nämlich die AfD ans Werk, Deutschland zu verändern. So wundervoll in Vergessenheit geratene Schlagwörter feiern Zangenwiedergeburten: Lügenpresse, Volksverräter, Bürgerwehr, Grenzkontrollen, Abschiebungen, Heimatschutz, Fackelmarsch. Man erwischt sich dabei, Angst vor denen zu haben, die Angst haben.
–
Die satten und gemütlichen Herr und Frau Biedermeier, sie blicken sich heuer verwundert um, ungläubig die verschlafenen Augen reibend. Irritation, Verwunderung. Dumm nur: Am Ende steht oft die nackte, echauffierte Panik und nennt sich selber pseudokritisch „Sorge“.
Sieht man der Realität ehrlich und pragmatisch ins Auge, dann erkennt man einen neuen Umstand, der den Zeitgeist mit prägt: Aus Deutsch- wird ein Einwanderungsland.
Aus Kasernen werden Flüchtlingsheime, Rentner werden zu Sprachlehrern, Kulturvermittlern und Integrationsbeauftragten, generationenübergreifende Politikverdrossenheit verwandelt sich in leidenschaftliche, mitunter jenseits aller Gürtellinien geführte Diskussionen, sowohl auf der Straße als auch in Chaträumen. Die oft stocksteife und bierernste Haltung der Deutschen, definiert durch Recht und Ordnung, weiß plötzlich nicht mehr, woran genau sie sich festhalten soll.
Endlich, mag man manchmal denken, endlich ist mal wieder etwas los. Denn wo, wenn nicht in seiner effizienten Lösungsorientiertheit, kann der Deutsche zeigen, was in ihm steckt? Ärmel hoch, es gäbe einiges zu tun.
„Deutschland wird sich verändern“ heißt es heuer ständig und es klingt wie eine Drohung. Sorgen haben viele Menschen: Um ihren Ist-Zustand und vor den Einschränkungen oder dem viel beschworenen „Kraftakt“. Oder am Ende einfach davor, dass all die Neuankömmlinge nicht verstehen, wann welcher Müll wohin entleert wird, was eine große Anzahl Alteingesessener ebenso wenig begreifen mag.
„Wir schaffen das“ wird motiviert und dabei verhältnismäßig selten von Chancen und Möglichkeiten gesprochen, die ohne Risiken und Nebenwirkungen bekanntlich leider nur sporadisch auftauchen. Veränderung und Umbruch, ein Bürgerschreck für Konservative, eine Triebfeder für die Motivierten und Ideenreichen. Eine Gleichung könnte sein: Wer sich im Privaten nicht verändern mag, wird es in der Gesellschaft auch nicht hinnehmen wollen, wenn sich ein Status Quo umwälzt. Auch dann nicht wenn es notwendig oder aus humanistischer Sicht vielleicht angebracht wäre. Aber wenn der Wandel am Ende, trotz aller Schmerzen und Funken zu einer Horizonterweiterung führt?
Die Progressiven begreifen eine Veränderung meist als Chance und sind neugierig auf die sich mitunter bietenden Möglichkeiten, weshalb sie oft übermotiviert oder naiv auf die Besorgten, auf die Traditionalisten und Konservativen wirken mögen.
Die Konservativen hingegen haben Angst vor dem Unbekannten und strahlen in ihrer Furcht etwas unausschlafbar lebensmüdes und kleingeistiges aus. Es liegt ja schließlich im Wortlaut, wer etwas so erhalten möchte wie es ist, der mag die Veränderung nicht. Man mag es nachvollziehen können, in der katholischen Kirche, in traditionsorientierten Familienunternehmen, in schlagenden Verbindungen. Manche Werte sollte man versuchen zu bewahren, gewiss. Manch einer Organisation steht auch eine dicke Kruste aus Altbekanntem bestens. Allein: Wie realitätsfern ist diese Denke, wenn man sie auf eine globalisierte Gesellschaft anwenden möchte? Eine Gesellschaft ferner, die vor allem die positiven Effekte dieser wirtschaftlichen Entwicklung zu spüren bekommen hat, seit Jahren und Jahrzehnten? Wie inkonsequent, feige, verbohrt muss man sein, wenn man nun, da die Probleme dieser Entwicklung nicht mehr von der Hand zu weisen sind, meint man könne diese Folgen ignorieren, ablehnen, rückgängig machen?
Wie bereit bin ich selbst, mich zu verändern, Umbrüche anzunehmen und ungemütliche Umwege zu gehen?
Immerhin ist mein Leben eine einzige Komfortzone: Männlich, weiß, mit beiden Beinen im Leben, beschenkt mit einer fürsorglichen Familie, solventen Arbeitgebern, guten Freunden und einem im weitesten Sinne funktionierenden Sozialsystem, fernab von Seuchen, Naturkatastrophen, Kriegen und Trump-ähnlichen Gestalten. Was passiert, wenn ich diese Komfortzone verlasse? Wie aufgeschlossen bin ich selbst Veränderungen gegenüber? Was macht diese Reise mit mir?
Die „Friss’, Hund – oder stirb!“ – Mentalität ist ja eine sehr pragmatische: Vieles geschieht also ohne Umschweife und, ja, einfach so. Ich tausche automatisch sehr hippen und aufregenden Berliner Streetfood gegen bodenständige deutsche Gerichte, Altbauwohnung gegen Zelt, sicherlich eitel zusammengestellte Kleidung gegen Funktionsklamotten, Monitore gegen weite Blicke und die Ausstrahlung einer aufregenden Stadt gegen den spröden Charme der Provinz.
Nach etwa drei Wochen Reise, zwischen Görlitz und Bautzen hat sich die Belastbarkeit meines Körpers grundlegend geändert. Die Abstriche in den ehrgeizigen und bisweilen entsetzlich naiven Zielen in Bezug auf meine tägliche Laufdistanz hat er mir gedankt und ist nun an das Gehen gewöhnt. Mittlerweile habe ich auch gelernt, wie man den Rucksack effektiver und vor allem rückenschonender packt. Meine Füße sind deutlich breiter, als zu Beginn der Reise, die Oberschenkel und Waden dafür erheblich dünner und definierter. Mein Bart wird länger, die Haut für meine sehr blassen Verhältnisse braun gegerbt. Ich benötige nicht mehr so viel Schlaf wie zu Beginn und habe dadurch mehr Zeit zum Marschieren. Schmerzen sind jetzt nicht mehr die Regel sondern die Ausnahme. Und so wie die deutsche Mentalität es einem gerne vorgibt – „Schaffe, schaffe, Häusle baue!“ / „Von Nichts kommt nichts!“ / „Wer rastet der rostet!“ undsoweiterundsofort – so bin auch ich unglücklich, wenn mein Körper seinen ganz eigenen Sturm & Drang nicht ausleben darf. Mit dieser physischen Veränderung zum Guten und Belastbaren hin, verändert sich auch mein Selbstvertrauen: Ich bin mir meiner nun sehr sicher. Ich bin hier, weil ich hier sein möchte. Ich halte das Stehen und Verweilen nur schwer aus und habe mich daran gewöhnt, dass die Welt, die Dörfer, die Menschen an mir vorüberziehen. Bleibe ich irgendwo um zu rasten, zieht es mich sehr schnell wieder weiter, weiter, immer weiter. Ich muss also nun ständig in Bewegung sein, meine Lebenswelt ist die Veränderung geworden.
Mit mir und um mich herum verändert die Zeit den Raum.  Karge Bäume beginnen zu knospen, jeder Tag gibt nun spürbar mehr Licht und Wärme, plötzlich laufe ich durch strahlend gelbe Rapsfelder und sehe wie die Landwirte ihre Felder bestellen. Immer mehr Menschen werkeln in immer farbenfroher erblühenden Schrebergärten. Gehämmer, Gekehre, Gekärcher. Und zwischen all den Deutschen, die nun wieder emsig ihre Autos putzen und ihren Rasen pflegen, sieht man immer wieder kleine und exotisch anmutende Gruppen – es sind die neuen Mitmenschen. Sie verändern das Vertraute und sind durch ihr Anderssein Reize im faden, deutschen, ländlichen Spießbürgertum. Unerwartetes im stets Vorhersehbaren.
Karge Bäume beginnen zu knospen, jeder Tag gibt nun spürbar mehr Licht und Wärme, plötzlich laufe ich durch strahlend gelbe Rapsfelder und sehe wie die Landwirte ihre Felder bestellen. Immer mehr Menschen werkeln in immer farbenfroher erblühenden Schrebergärten. Gehämmer, Gekehre, Gekärcher. Und zwischen all den Deutschen, die nun wieder emsig ihre Autos putzen und ihren Rasen pflegen, sieht man immer wieder kleine und exotisch anmutende Gruppen – es sind die neuen Mitmenschen. Sie verändern das Vertraute und sind durch ihr Anderssein Reize im faden, deutschen, ländlichen Spießbürgertum. Unerwartetes im stets Vorhersehbaren.
Selbstverständlich spüre ich, dass sich auf den Markt- plätzen etwas verändert. Ich kann es in Berlin und Hamburg und den anderen großen Städten nicht erkennen, denn dort gehören „die anderen“ – die Asiaten, die Afrikaner, die Muslime – schon lange zu den Freunden, Kollegen, Nachbarn, Vollidioten mit denen man sich sein Leben auf engem Raum teilt. In kleinen Städten ist dies anders. Hier fällt auf, dass mehr Menschen mit offensichtlichem Migrationshintergrund die Fußgängerzonen und Stadtparks beleben. Und nach drei Wochen provinzieller Tristesse, nach immer größeren Werbebannern, die die Einwohner mahnend daran erinnern „Kauft im Ort – Nicht im Internet! Belebt den lokalen Einzelhandel!” oder „Haltet die Lehrlinge in der Region!“, nach etlichen Kilometern hochgeklappter Bürgersteige und diversen Abenden mit allein auf Marktplätzen und Kleinstadtzentren verbrachten Stunden, nach all den ungezählten, engbestirnten Blicken, dem hastigen an mir Vorbeigegehe der Deutschen und den meist freundlichen, oft lächelnden, gar einladend herbeiwinkenden Blicken der geflüchteten, vermeintlich traumatisierten, der Heimat entrissenen und hier Fremden, nach all dem bin ich erleichtert, dass es diese Veränderung gibt.
Ich wünsche diesen deutschen Orten und deren Einwohnern, den Jungen sowie den Alten, den Urgewächsen und den Nachzüglern, diese Aufgabe als eine Möglichkeit zu begreifen. Denn die einzige Chance, die jene Verbliebenen und noch nicht in erfolgreichere Landstriche Abgewanderten sich zu geben scheinen, liegt in einem saisonalen Tourismus und der Hoffnung, dass der nächste Sommer wieder ein bisschen besser wird als der aktuelle. Liebe Rheinsbergs, Neuruppins, Mirows, Bautzens, Pirnas, Heidenaus, Merseburgs und was sonst noch alles in der Provinz einen Namen und eine Lage hat: Das kann doch wirklich nicht alles sein. Da habt ihr eine Aufgabe an der ihr wachsen könnt, vielleicht nicht ökonomisch, aber im Selbstwert und beim Blick in den Spiegel, in der Gemeinschaft, kulturell und schließlich auch aneinander. Nehmt sie an, anstatt nur die eigene Angst zu sehen, die langsam aber sicher die Seelen auffrisst.–
Denn welche Angst ist plausibler: Die German Angst der Etablierten Erstweltler, die zwischen feng-shui-istisch platzierten Buddhastatuen und mit Rasenmähertrekkern gepflegten Grünflächen ihren Zweitwagen aus dem Carport drapieren, um die Kleinen zum Sport- oder Klavierunterricht zu chauffieren? Die ständig ihre Rundum-Sorglos-Versicherungspakete erweitern, während sie über Paleo- oder Low-Carb diskutieren, davon einen Food-Porno nach dem anderen produzieren, den sie mit den neuesten Katzenbabyvideos über sämtliche digitalen Kanäle verteilen, während sie sich gleichzeitig um den drohenden, gläsernen Bürger sorgen? Die mit ihrer Zeit oft wenig sinnstiftenderes anzufangen wissen, als über Displays zu wischen und coelhoeske Lebensweisheitsplattitüden in Comic-Sans in den digitalen Äther zu sharen? Die es wirklich als Grund zur Schnappatmung auffassen, wenn der Bio-Sellerie vergriffen ist oder sie ihre Schaumstoffmatten einmal nicht in der örtlichen Turnhalle ausrollen können, weil dort statt einem Yoga-Unterricht leider vor einem Krieg geflohene Menschen untergebracht sind?
Oder aber die Angst der Geflohenen selbst, die fernab ihrer Heimat, entrissen von jedem Hab und Gut, inmitten einer fremder Kulturen, Sprachen, Klimazonen und einer über alle Grade verwirrenden und abstrakten Bürokratie einfach nur versuchen anzukommen und den Schrecken der vergangenen Jahre – Fassbomben, Hinrichtungen, Terror – aus ihren Köpfen zu bekommen? Und seien ihre Gründe nicht so dramatisch gewesen: Die einfach ihr Recht auf ein besseres Leben versuchen, in die Tat umzusetzen?
Um die Veränderungen zu akzeptieren und anzunehmen, müssen wir die Ängste und Sorgen ausblenden, kurz vergessen, darüber hinwegsehen. Natürlich wird das anstrengend, aber wer ist nicht versucht hat ja schon verloren, oder?
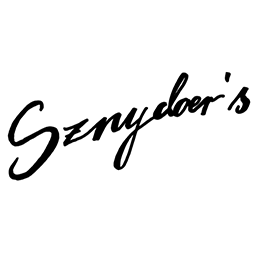



Leave a Reply