COTTBUS – GÖRLITZ
–

Und dann liegt da plötzlich Görlitz vor mir und nach dem verregneten Spreewald und dem verbitterten und an sich selbst leidenden Cottbus kann man diesen Anblick kaum fassen. Eine Stadt wie Stein gewordenes Fingerspitzengefühl. Ist das noch Deutschland? Wo bin ich hier gelandet und wieso war ich zuvor noch nie an diesem Ort?
Görlitz ist kein geplanter Halt auf meinem Weg gewesen, es liegt bloß von Cottbus aus so günstig zu erreichen und meine Denkvarianz wollte nichts außer flüchten aus diesem düsteren Ort und nahm den erstbesten Zug. Und dann stehe ich in Görlitz am Bahnhof und weiß erst einmal nicht so richtig, was ich von dieser Stadt halten soll. Sonntagmittags im Nieselregen wirkt sie zuerst wie Berlin-Neukölln zur gleichen Tageszeit, denn die Stadt gehört mir alleine. Nur ganz vereinzelt hat sich hier ein Pärchen und dort ein Einzelner nach draußen gewagt und als ich die ersten sechs, sieben leerstehenden und zu verkaufenden Geschäfte passiere, ahne ich bereits böses. Doch dann: Schnatterndes Leben, öffnende Restaurants, der Marktplatz füllt sich mit Busladungen von Touristen und Flaneuren. Ich ordne mich ein in einen Strom aus Menschen, welcher mich direkt zur Kirche St. Peter und Paul führt. Pünktlich um zwölf beginnt dort die Orgelstunde und weil ich sowieso, wie so oft, keine Vorstellung habe vom Rest des Tagesverlaufs, von diesem Weg, von diesem Ort, bleibe ich und lausche. Weil die Geschichte der Orgel und der Kirche erzählt und nicht gebetet wird, kann ich es sehr gut ertragen. Wissen vermitteln und durch die Akustik begeistern, nicht predigen – ein sonntägliches Konzept, das mir spontan sehr zusagt.
Ich checke anschließend in einer Jugendherberge direkt an der Neiße ein. Was liegt näher, als nach der Cottbusser Erfahrung von außen auf Deutschland zu blicken? Ich gehe also über die Brücke, und mache in Polen die menschlichste aller Erfahrungen, denn Deutschland sieht von hier betrachtet auf einmal so wunderschön aus, dass ich direkt wieder zurück möchte. Es ist und bleibt immer das Andere zu dem es uns zieht, es ist nie das was wir haben und wo wir sind und deshalb scheint konserviertes Glück und beständige Zufriedenheit ein unmögliches Unterfangen für den Menschen zu sein. Es ist auch eine Triebfeder des Menschen, dass das Gras stets grüner auf der anderen Seite wirkt.
Ich laufe einige Stunden kreuz und quer durch diesen Sanierungstraum und entdecke ausgerechnet in der „Verrätergasse“ herzerwärmende Straßenprosa: „Freiräume erhalten“ steht dort und „Freiheit für die Kunst.“ Ich finde eine Kaschemme, von der ich hoffe, dass es eine Bar ist. Vier sehr alternativ, also in diesem Wortgebrauch „punkig“ und „links“ aussehende Zeitgenossen betreten das Lokal und ziehen eine Haschischwolke hinter sich her. Ich drehe noch eine kleine Runde um dieses Carrée und versuche anschließend mein Glück, doch die Tür bleibt geschlossen.
Danach trinke ich einen Kaffee und esse ein Stück Kuchen in einer Bäckerei, in der ich der mit Abstand jüngste Kunde bin. Ich nehme im hinteren Raum Platz und befinde mich inmitten allerbester Sonntagsstimmung umgeben von dutzenden Rentnerinnen und Pensionierten. Allerbeste Tanzteezeit, dumm nur: Musik wird nicht gespielt. Ich könnte jetzt hier schwofen, mit einer netten Omi im Arm, immer wieder ein Stück Käsekuchen naschend.
Ich betrete die Touristeninformation, in der eine äußerst charmante Polin emsig Karten, Tassen, Souvenirs an den Kunden bringt. Der Kunde: Amerikaner, Chinesen, Italiener, Japaner, Deutsche. Eine tourismusgeschwängerte Atmosphäre hier wie am Brandenburger Tor, den Niagara-Fällen, Florenz. Ich muss mir ungläubig in Erinnerung rufen, dass ich mich in einer verhältnismäßig kleinen Stadt an der Deutsch-Polnischen Grenze befinde. Bis heute dachte ich bei solchen Orten an Frankfurt/Oder oder Eisenhüttenstadt. Nun bin ich am sinnieren darüber, ob die östlichste Stadt Deutschlands auch die schönste ist.
Ich telefoniere kurz mit meinem Vater, schwärme ihm vor, in was für einer prachtvollen Stadt ich mich befinde. Er erinnert mich daran, dass der BVB heute gegen seinen Angstgegner aus Hamburg spielt.„Freiräume erhalten“, denke ich und bleibe mir selber treu. Ich muss folglich natürlich in dem einzigen wirklich hässlichen Gebäude in Görlitz aufschlagen um dieses Spiel sehen zu können. Während in diesem Stein gewordenen Traum aus Renaissance, Barock und Gotik das Licht langsam schwindet, sitze ich in einem Einkaufs- und Spielhallenzentrum, das wahrscheinlich von einem westdeutschen Investor in der abscheulichen Perfektion der westdeutschen Sparkassenarchitektur in das Stadtzentrum verbrochen wurde, am Rande einer Bowlingbahn im zweiten Stock und schaue nach links aus getönten Scheiben und nach rechts auf ein sehr gestauchtes Leinwandbild. Ich verstehe die Abneigung des Ossis gegen den planierenden und alles bebauenden Wessi der Neunziger, ich teile seine Abscheu, wenn ich diese Kieferorthopädenpraxen, Einkaufszentren, die pseudofreundlichen Sozialwohnungen und Einfamilienhäusermonokulturen sehe. Mir kommt dieser neunziger Jahre Bauhorrorfilm weitaus brutaler und menschenfeindlicher vor, als die raue ostdeutsche Platte. Diese mag spröder sein und aus ungemütlichem Waschbeton errichtet, aber dafür wirkt sie authentisch und gibt in ihrer Härte nicht vergeblich vor, gemütlich sein zu wollen. Sie kommt pragmatisch und lösungsorientiert und damit typisch deutsch daher, während dieses Einkaufszentrum, in dem ich nun sitze, kläglich versucht, einen Hauch Amerika nach Görlitz zu bringen, dabei an sich selbst scheitert und hier nun steht wie ein vierundzwanzig Meter hoher Dorn im Auge einer ansonsten wunderschönen Stadt. Der Konsumkultur sei Dank.
–
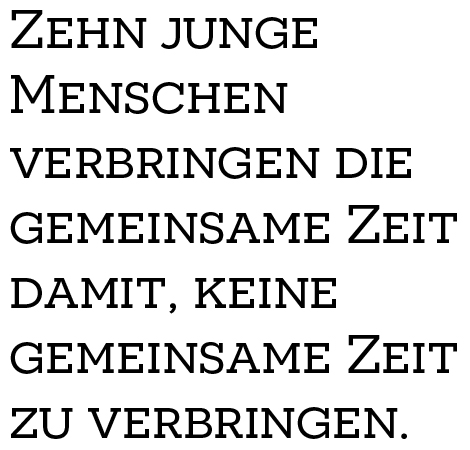 Bowlinggeräusche, Spielautomaten, Klingeltöne. Es ist natürlich nur mit einem Bier zu ertragen. Ich denke an das sehr aktuelle, sehr präsente Gerede über die Achtsamkeit. Leben im Moment, ohne multimediale Zerstreuung und gewhatsappte Ablenkung. Neben mir sitzt eine Gruppe, deren Mitgliederzahl ständig zwischen sechs und zehn Leuten variiert. Ich weiß auch zur Mitte der zweiten Halbzeit noch nicht, ob sie hier sind um das Spiel zu sehen, einfach etwas gemeinsame Zeit verbringen möchten, ihre sozialen Netzwerke bespielen oder mit Menschen außerhalb dieses Spielebunkers telefonieren müssen. Sie alle sind hier und dabei ist niemand von ihnen wirklich hier – es ist eigentlich ein analoger Ort, der durch ihr Verhalten und ihre Smartphones zu einem sozialen Nichtort per Definition verkommt. Und so wie ich die Schönheit dieser Stadt durch die getönten Scheiben des Spielecenters anschaue und eine absolut unspannende Bundesligaübertragung verfolge, so sitzt diese junge, hübsche Clique in ihrer digitalen Belanglosigkeit fest: Zehn junge Menschen verbringen die gemeinsame Zeit damit, keine gemeinsame Zeit zu verbringen. Hübsches Potential also, trist und an sich selbst gelangweilt. Früher hätte man sich unterhalten, denke ich.
Bowlinggeräusche, Spielautomaten, Klingeltöne. Es ist natürlich nur mit einem Bier zu ertragen. Ich denke an das sehr aktuelle, sehr präsente Gerede über die Achtsamkeit. Leben im Moment, ohne multimediale Zerstreuung und gewhatsappte Ablenkung. Neben mir sitzt eine Gruppe, deren Mitgliederzahl ständig zwischen sechs und zehn Leuten variiert. Ich weiß auch zur Mitte der zweiten Halbzeit noch nicht, ob sie hier sind um das Spiel zu sehen, einfach etwas gemeinsame Zeit verbringen möchten, ihre sozialen Netzwerke bespielen oder mit Menschen außerhalb dieses Spielebunkers telefonieren müssen. Sie alle sind hier und dabei ist niemand von ihnen wirklich hier – es ist eigentlich ein analoger Ort, der durch ihr Verhalten und ihre Smartphones zu einem sozialen Nichtort per Definition verkommt. Und so wie ich die Schönheit dieser Stadt durch die getönten Scheiben des Spielecenters anschaue und eine absolut unspannende Bundesligaübertragung verfolge, so sitzt diese junge, hübsche Clique in ihrer digitalen Belanglosigkeit fest: Zehn junge Menschen verbringen die gemeinsame Zeit damit, keine gemeinsame Zeit zu verbringen. Hübsches Potential also, trist und an sich selbst gelangweilt. Früher hätte man sich unterhalten, denke ich.
–
Als das Spiel abgepfiffen wird und Dortmund seinen nun ehemaligen Angstgegner geschlagen hat, gehe ich über die zentralen Plätze von Görlitz, setze mich und schaue was passiert. Sie sind vollständig in der Hand der vermeintlich Fremden. Keine Italiener, Japaner oder Amerikaner sind um diese Zeit zu sehen, sondern Syrer, Türken, Afghanen. Sie tragen kein Geld in dieses Schmuckstück einer Stadt, doch sie erfüllen es mit Leben. Fremde, Geflüchtete, Grüppchen an exotisch wirkenden Migranten oder Mitbürgern überall, kein einziger Deutscher sitzt hier und nimmt am öffentlichen Leben teil. Und Leben, St.Peter und Paul sei Dank, findet hier reichlich und ermunternd statt: Jugendliche spielen fangen, Männergruppen stützen sich auf ihre Spazierstöcke auf, trinken Kaffee und diskutieren, Frauengruppen lamentieren oder lachen schallend, ein Kleinkind weint und kreischt, die friedliche Stimmung zerschneidend, bis es von seinem älteren Bruder getröstet und mit der Umwelt versöhnt wird. Jeder, wirklich jeder zu dem ich Blickkontakt aufbaue grüßt mich. Eine Parallelgesellschaft, ganz klar. Aber eine tragische oder befremdliche? Mitnichten. Ich kann es verstehen, wenn sich der Görlitzer, der hier aufgewachsen ist, bei all den Besuchern und Gästen fremd in seiner Heimatstadt vorkommt. Doch was mag befremdlicher wirken: Die Touristen über den Tag verteilt oder die Migranten, die erst auffallen, wenn die Touristen die Stadt verlassen haben und weiter gezogen sind in Richtung Dresden oder Berlin oder Polen?
Langsam aber sicher legt sich dieser Tag und dieser Ort über den in mir nachhallenden Cottbuser Realalptraum. Ich danke diesem frisch marmorierten Platz und den Menschen, die ihn mit Leben erfüllen und mit einer lustbetonten Einstellung, mit Geschichten von denen ich kein Wort verstehe, aber für deren schlichtes Beschallen der dahin dösenden Straßen ich eine tiefe Verbundenheit empfinde. Ich winke ihnen zu, sie winken mir verwundert zurück und ich verlasse den Glanz von Görlitz’ Innenstadt in Zuversicht und Harmonie.
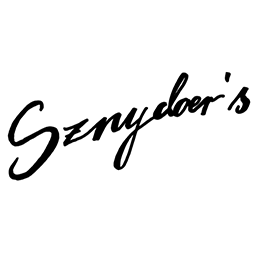



Leave a Reply